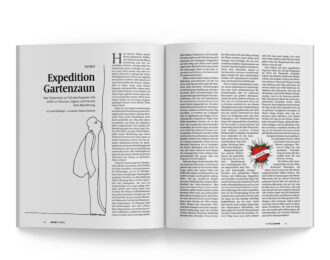›Die totale Freiheit bedeutet Isolation‹
Wie ich gegen Klimaaktivistin Katharina Rogenhofer protestierte.
Katharina Rogenhofer steht mitten im Café Westend und winkt mich fröhlich zu sich. Die Sprecherin des derzeit laufenden Klimavolksbegehrens scheint generell ein freundlicher und fröhlicher Mensch zu sein. Aber wie geht das eigentlich: fröhlich zu bleiben, wenn sie sich Tag und Nacht mit der wohl größten Gefahr befasst, der sich die Menschheit jemals gegenübersah? Wenn sie tagtäglich erlebt, wie Politik und Gesellschaft daran zu scheitern drohen? Wie geht sie mit diesem Frust um? Der Frust war vorher ja auch schon da. Mit vorher meint sie die Zeit, als sich ihr Bemühen um Umwelt- und Klimaschutz auf ihren persönlichen Lebensstil, ihre individuellen Konsumentscheidungen beschränkt hat. Ohnmächtig habe sie sich da gefühlt, frus-triert, weil sie sich bei jeder Kleinigkeit selbst geißelte, während klimaschädigendes Verhalten um sie herum immer noch die Norm gewesen sei. Dann kam Greta Thunberg in ihr Leben.
Bei der Klimakonferenz im polnischen Katowice lernte sie die schwedische Aktivistin kennen, und nach ihrer Rückkehr meldete sie mit zwei Freunden, Johannes Stangl und Philipp Wilfinger, die erste Fridays-For-Future-Demonstration in Wien an. Dadurch haben wir uns gewissermaßen selbst ermächtigt, das hat mir persönlich sehr geholfen. Der Schritt in den Aktivismus war getan, Rogenhofer begann sich für das Klimavolksbegehren zu engagieren und übernahm im April die Funktion der Sprecherin dieser Initiative. Das Volksbegehren ist derzeit noch in der Unterstützungsphase und steuert dennoch bereits auf 100.000 Unterschriften zu. Der Weg von der Naturwissenschaftlerin in den Aktivismus war kein leichter. Ich fühle mich auch heute noch zwei- bis dreimal am Tag komplett fehl am Platz. Sie lacht, wenn sie das sagt, schlägt aber gleich ins Ernste um: Wir müssen leider akzeptieren, dass Zahlen, Daten und Fakten, so eindeutig sie auch seien, Menschen nicht dazu bringen umzudenken. Wenn dem so wäre, hätte man bereits vor 30 Jahren begonnen zu handeln. Wie also dann die gebotene Dringlichkeit vermitteln? Wir brauchen Geschichten. Geschichten von Menschen, die die Klimakrise bereits spüren, die bereits etwas dagegen tun. Das würde ich mir auch von den Medien wünschen, dass sie diese Geschichten aufspüren und weitererzählen.
Es geht also um die Erzählweise, mit der der Kampf gegen den Klimawandel greifbar gemacht werden soll, und da wird Rogenhofer plötzlich nicht so fröhlich: Was ich hasse, ist diese Verzichtserzählung, die sich meistens gegen Autos oder das Fliegen richtet. Aber niemand redet davon, worauf wir jetzt schon und bald noch viel mehr verzichten: Gute Luft, grüne Flächen, eine sichere Zukunft. Das bringt mich zu der Frage, über die ich eigentlich mit Rogenhofer sprechen wollte: Wie kann sich ein effektiver Kampf gegen den Klimawandel mit unserem gängigen Freiheitsbegriff ausgehen? Ihre Antwort verblüfft mich: Vielleicht müssen wir Freiheit überhaupt aus der Erzählung nehmen, und uns fragen, was uns Glück bringt. Ein intaktes gesellschaftliches Umfeld, gute Beziehungen und soziale Absicherung – das ist doch Lebensqualität, nicht irgendein komischer Freiheitsbegriff. Aber Freiheit, protestiere ich. Ich kann damit wenig anfangen. Freiheit heißt immer auch, sich von etwas abzukappen. Also bedeutet die totale Freiheit letztlich immer Isolation. Und wer will das schon?
Sie können die gesamte Ausgabe, in der dieser Artikel erschien, als ePaper kaufen:
Bei Austria-Kiosk kaufen