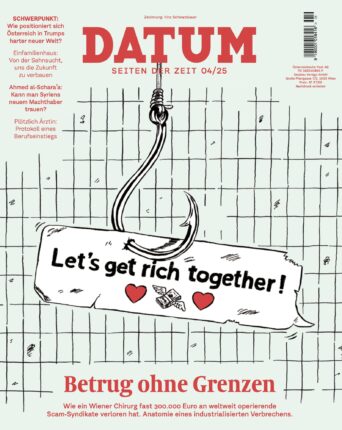Das Wissen der Erschütterten
Was wir von Menschen lernen können, die Schlimmstes erlebt haben.
Es ist seltsam, wenn alles Humanistische plötzlich einen weltfremden Beigeschmack bekommt. Als müsste man sich dafür schämen, in Zeiten von Möchtegernkönigen und Aufrüstungsfanfare, sich ganz dekadent mit dem Geist und seiner Kultivierung zu beschäftigen. Besser, man bereitet sich ganz praktisch auf den Zusammenbruch der Welt und ihrer Ordnung vor. Lieber sich anmelden für einen Kurs in Wie-kochen-im-Bunker, Drohnenbasteln und Mullbinden wickeln, als mit Literatur, Philosophie und Kunst seinen Glauben an die Menschheit aufrechtzuerhalten. Derzeit darf ich mich für einige Monate auf so einem vermeintlich weltfremden Planeten aufhalten, dem Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Hier, bei der Friedensbrücke in Wien, denken Historiker, Philosophinnen, Politikwissenschaftler und Journalistinnen darüber nach, wie das mit dem Menschsein zu bewältigen ist.
Es ist eine kleine, gedankenversunkene Insel voll Hadern und Hoffnung in höflicher Distanz zu allen Immerschonwisserinnen und Sofortlösungsfetischisten. Ein trotziges Weitermachen und Weitergrübeln, das vielleicht den einen oder anderen Kompass eines Tages außerhalb dieser Wände anders ausrichten lässt. Wer Glück hat, wird gestreift von dieser wunderbar trotzigen Dekadenz, wenn am Gang über die Möglichkeit eines glücklichen Lebens in Regimes geplaudert wird oder beim Mittagessen in der Kantine über die Rolle tschechischer Theaterkritikerinnen in den 1930er-Jahren.
Oder wenn man unerwartet in einen Lesekreis zu Essays von Jan Patočka stolpert und zum ersten Mal von einem Konzept erfährt, das einen unbewusst sein ganzes Leben begleitet hat. Patočka, tschechischer Philosoph und Sprecher der Charta 77, der Bürgerrechtsbewegung gegen das kommunistische Regime in der Tschechoslowakei, hat in einem seiner letzten Essays über die ›Solidarität der Erschütterten‹ geschrieben. Er, der Dissident, der unmittelbar nach der Einvernahme durch die Geheimpolizei an einem Schlaganfall starb, behauptete, dass die Fronterfahrung im Krieg eine Art Schicksalsgemeinschaft hervorgebracht hat, eine ›Solidarität der Erschütterten‹. Sie, die mit dem Tod in Berührung gekommen sind, wüssten, was das Leben bedeutet. Und zwar ausschließlich sie. Dieses Wissen und diese Erfahrung befähigt sie, Nein zu zukünftigen Gräueln zu sagen. Elitär sei der Gedanke, wird im Lesekreis diskutiert. Wer das Schlimmste erlebt hat, muss nicht unbedingt einen Tau vom Leben haben.
Aber ist nicht etwas dran an der Idee – ohne das Leid verherrlichen zu wollen und ihm eine unnötige Tiefe zuzuschreiben –, dass die Erschütterten dieser Welt tatsächlich auch heute noch, wenn nicht ein besonderes Band, doch zumindest ein Wissen teilen? Sie kennen eine Welt, die in Schutt in Asche liegt, die nicht zu ihren Gunsten funktioniert und in der auch keiner sich dafür interessiert, ob sie das je tut oder getan hat. Darum zu beneiden sind sie nicht.
Aber wie es nun einmal gute, privilegierte Tradition ist, lässt sich dieses Wissen und diese Ressource der Erschütterung doch anzapfen: Daraus lernen, als Vorbereitung. Wenn unsere Generation etwas ist, dann sind wir Kontrollfreaks, die für jedes Szenario gewappnet sein wollen, als läge im guten Prepping bereits ein Teil der Lösung, die das Schlimmste abfedern kann. Denn in Wahrheit ahnen auch wir, die wir bislang nicht Teil dieser Schicksalsgemeinschaft waren: Früher oder später könnten wir diesem Club der Erschütterten angehören. Und wir haben keine Ahnung, wie wir damit umgehen werden.•