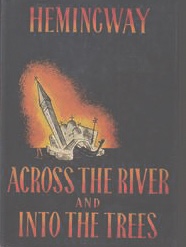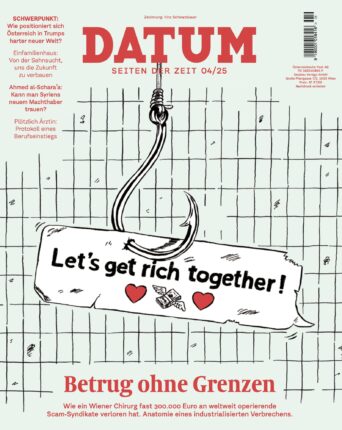Erschreckende Relektüre
Der Krieg verändert alles. So führt die Rückkehr des Krieges nach Europa durch Russlands Überfall auf die Ukraine – neben vielen handfesten Konsequenzen – unter anderem auch dazu, dass man als Leser die Kriegs- und Nachkriegsliteratur zweier Weltkriege noch einmal mit anderen Augen und in neuem, schärferen Licht sieht.
Ernest Hemingways Roman ›Über den Fluss und durch die Wälder‹ ist heuer genau ein Dreivierteljahrhundert alt. Es ist eine knapp erzählte Geschichte über einen US-Colonel, der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Venedig die letzten Tage seines Lebens in leidenschaftlicher Liebe mit einer viel jüngeren Frau verbringt. Der seelisch beschädigte Veteran versucht, die in seinem Inneren immer wieder auferstehenden Bilder des Krieges nicht bestimmend werden zu lassen – nur um bald den körper-lichen Folgen seiner Zeit an der Front zu erliegen.
›Über den Fluss und durch die Wälder‹ ist nicht Hemingways stärkstes Buch, die Liebesgeschichte der beiden Hauptpersonen grenzt in ihrer Melodramatik mitunter an Kitsch. Aber während einem dieser Colonel Richard Cantwell bis vor wenigen Jahren noch wie ein kostümierter, tragischer Held einer längst vergangenen Epoche erscheinen musste, tritt er uns heute – parallel gelesen zu Reportagen vom ukrainischen Abwehrkampf und seinen Veteranen – auf den Buchseiten plötzlich als Zeitgenosse gegenüber. Das ist mitunter ziemlich erschreckend – und ein guter Grund, warum man diesen und andere Romane über die ›Verlorene Generation‹ des 20. Jahrhunderts heute noch einmal lesen sollte.
Originalausgabe:
›Across the River and into the Trees‹ (1950)
Autor: Ernest Hemingway