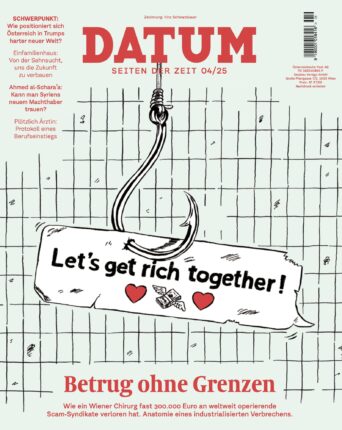Plötzlich Ärztin
Unsere Autorin hat sich jahrelang vorbereitet – und war dennoch überrascht, wie es sich anfühlt, auf einmal für Leben und Überleben von Patienten verantwortlich zu sein.
In welchen OP soll ich heute gehen?‹, fragt Konstantin, ein Medizinstudent. ›Frag am besten mal die Ärzte‹, antworte ich ihm reflexartig. Er schaut mich verdutzt an, ich schaue ebenso verdutzt zurück. Und dann trifft es mich: Ich bin die Ärztin. Genau deshalb fragt er mich. Es ist kurz nach sieben Uhr morgens, mein Gehirn ist offenbar noch nicht ganz wach.
Ärztin bin ich erst seit wenigen Wochen. Noch vor zwei Monaten war ich selbst Studentin im Klinisch-Praktischen Jahr. Danach kam das Staatsexamen und mit ihm der Studienabschluss. Dann lag mein Diplom im Briefkasten und der Umzug stand an. Denn studiert habe ich in Deutschland und bin für meine erste Arbeitsstelle nach Österreich gezogen. Und jetzt, einen Monat nach dem Examen, stehe ich hier – in einem Krankenhaus in einer österreichischen Landeshauptstadt – und blicke überrascht zu Konstantin. ›Arzt/Ärztin in Basisausbildung‹ steht in kleinen grünen Buchstaben auf meinem Namensschild – damit bin ich eine von etwa 1.100 Basisärztinnen und -ärzten bundesweit. Die Basisausbildung ist in Österreich die erste verpflichtende Station nach dem Medizinstudium. Sie dauert neun Monate und umfasst jeweils 3-monatige Rotationen in verschiedenen Fachbereichen. Während der Basisausbildung arbeiten die Jungärztinnen und -ärzte unter Anleitung erfahrener Ärzte, versorgen Patienten, übernehmen organisatorische Aufgaben und lernen den Klinikalltag aus einer neuen Perspektive kennen.
Es ist der 3. Jänner 2025, der erste Arbeitstag im neuen Jahr und der erste richtige Arbeitstag meines Lebens. Noch fühle ich mich in meinem weißen Mantel wie ein Teenager, der Arzt spielen darf. Mein Kopf ist voller Fragen: Kann ich in diese Rolle hineinwachsen? Oder bleibt das Gefühl der Unsicherheit und Angst mein ständiger Begleiter? Werde ich meinen Platz im System Krankenhaus finden?
In den letzten Wochen wurde ich oft zum Ende meines Studiums beglückwünscht. Doch so richtig freuen konnte ich mich nicht, immerzu kreisten meine Gedanken um den baldigen Arbeitsbeginn. ›Du schaffst das schon‹, schienen alle zu wissen. Doch am Ende bin ich diejenige, die es tatsächlich schaffen muss, und gerade bin ich mir dessen alles andere als sicher.
Nach zwei Wochen in der Notfallambulanz bin ich das erste Mal auf einer Station eingeteilt. Am dritten Tag fragt mich ein Patient im Vorbeigehen, ob er seine Blutverdünner wieder nehmen darf. ›Ich muss das nachschauen‹, antworte ich und gehe ins Arztzimmer. Gerade öffne ich seine Akten, als plötzlich eine Pflegekraft hereinstürmt: ›Herr S. blutet!‹ Sofort eile ich ins Verbandszimmer. Dort sitzt der Patient auf dem Untersuchungssessel und hält eine Papierschale unter sein Kinn. Langsam tropft das Blut aus seiner Nase – wie aus einem alten Wasserhahn, der gerade zugedreht wurde. Er wirkt beunruhigt, aber nicht überrascht. Seit Tagen ist er wegen wiederkehrenden Nasenblutens in unserer Klinik. Um die aktive Blutung zu stoppen, hat Herr S. bereits seit einigen Tagen spezielle aufblasbare Tampons in der Nase, sogenannte Tamponaden. Diese sollten heute entfernt werden. Doch nun blutet es wieder. Ruhig frage ich ihn: ›Wie lange blutet es schon?‹
›Seit ein paar Minuten‹, antwortet er. Langsam beruhigt sich Herr S. Ich rufe meine erfahrene Kollegin an, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Während ich noch am Telefon bin, hört die Blutung jedoch von selbst auf. Für den Moment ist das Problem gelöst, und Herr S. kann in sein Zimmer zurückkehren. Trotzdem benötigt er eine Operation. Ab heute Abend darf er nichts mehr essen, morgen geht es in den OP.
Erst eine Stunde später fällt mir auf: Ich habe dem Patienten mit den Blutverdünnern immer noch keine Antwort auf seine Frage gegeben! Zum Glück steht sein Name auf meinem Notizzettel. Ich fange an, mich wieder in seine Krankengeschichte einzulesen. Er ist frisch operiert und hat eine Herzerkrankung. Einerseits braucht er seine Blutverdünner dringend, um einem Schlaganfall oder Herzinfarkt vorzubeugen. Andererseits birgt die frische Operation ein hohes Blutungsrisiko. Eine heikle Entscheidung, die genaues Abwägen erfordert.
Im Studium habe ich unzählige Wirkmechanismen komplizierter Medikamente und endlose Listen mit Nebenwirkungen auswendig gelernt. Doch hier, in der Praxis, fehlt mir die Erfahrung, um das Risiko genau einzuschätzen. Ich muss mir Hilfe holen. Mir wird die Tücke der Arbeit als Stationsärztin klar. Alle paar Minuten klingelt mein Telefon: Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Logopäden, Ernährungstherapeuten und Kollegen aus anderen Abteilungen haben Fragen oder Bitten. Hier fehlt eine Medikamentenverordnung, dort ein Häkchen im System, anderswo eine Unterschrift. Ich schwimme in einem endlosen Strom an Aufgaben. Doch in diesem Strom gibt es einige wenige Dinge, die wirklich wichtig sind. Und nicht immer treten sie als akute Blutung auf. Manchmal sind es die leisen, beiläufig gestellten Fragen, die über das Wohl eines Patienten entscheiden.
An diesem Tag bin ich noch dazu nahezu alleine für die Station verantwortlich. Die Abteilung ist durch Krankenstände unterbesetzt, und die Assistenzärztin, die für mich verantwortlich ist, musste in den OP. Dabei hat Österreich im OECD-Ländervergleich die höchste Arztdichte mit 14,4 Ärztinnen und Ärzten pro 100.000 Einwohnern. Trotzdem herrscht in manchen Regionen Personalmangel. So hat Wien die höchste Ärztedichte, das Burgenland hingegen eine der niedrigsten. Und auch ohne Personalmangel kann es temporär zu Lücken kommen. Im klinischen Alltag ist das sofort spürbar, da der Patientenstrom trotzdem der Gleiche bleibt und mit ihm auch die Menge an nicht aufschiebbaren Aufgaben.
Den Tag über arbeite ich meine To-do-Liste ab. Hauptsächlich besteht sie aus administrativen Aufgaben: Untersuchungen anmelden, Kollegen aus anderen Abteilungen kontaktieren, Medikamente überprüfen und übertragen. Zwischendurch muss ich eine Patientin für eine Computertomographie aufklären. Zügig erkläre ich ihr den Ablauf, den Grund, die Risiken der Untersuchung, frage nach wichtigen Vorerkrankungen und Allergien. Dreimal klingelt mein Telefon und unser Gespräch wird unterbrochen. Jedes Mal krame ich meinen Notizzettel aus der Manteltasche. Und jedes Mal muss ich ein bisschen kleiner schreiben, weil auf dem Zettel kein Platz mehr ist.
›Haben Sie noch Fragen?‹ Sie hat keine mehr. Ich trage meinen Namen ein, in Druckbuchstaben, so die Vorschrift. Mein Name kommt mir so fremd vor, in krakeliger Schrift steht er da, darunter ›Arzt/Ärztin‹. Ich unterschreibe, sie unterschreibt ebenfalls. Schnell stehe ich auf und setze mich in Bewegung. Doch die Spitze meines Mantels bleibt am Stuhl hängen und einige Kugelschreiber fallen aus meiner Manteltasche. Beim Versuch, sie aufzuheben, beuge ich mich hinunter – ein Anfängerfehler! Denn sofort entleert sich auch der restliche Inhalt meiner Kitteltaschen auf den grauen Linoleumboden. Noch fünf weitere Kugelschreiber rollen in alle Richtungen des Raumes, mein Licht zur Überprüfung von Reflexen und ein spezieller Haut-Filzstift, den ich benutze, um die richtige Seite für bevorstehende OPs zu markieren, rollen hinterher. Meine zwei Notizbücher, eins für wichtige Informationen und eins für To-dos, fallen plump auf den Boden. Ebenfalls eine FFP2-Maske, mit der ich mich vor ansteckenden Patienten schütze, ein sauberes Paar Handschuhe, das ich für alle Fälle dabeihabe und ein einzeln verpackter Lotus-Keks für absolute Hungernotfälle. Dazu mein Diensttelefon und natürlich auch mein Smartphone – sehr nützlich, um Medikamente von Patienten zu identifizieren.
Oft genug begebe ich mich mit Patienten gemeinsam auf eine Schnitzeljagd durchs Internet, um genau das Medikament zu identifizieren, das sie einnehmen. Die Informationen, mit denen ich arbeite, klingen dann so: ›Irgendwie mit »Tu« oder »Ti« beginnt es, es ist so ein englischer Name, und wissen Sie, das ist so eine blaue Schachtel mit einem weißen Strich drauf.‹
Hastig sammle ich unter den Blicken der vier Patientinnen im Zimmer meinen kleinen Hausrat wieder ein. Einige Kugelschreiber fallen dem Unfall zum Opfer. Ich müsste jetzt peinlich berührt sein, doch dafür fehlt mir die Energie. ›Bis später‹, murmle ich und verlasse das Patientenzimmer. Das Gewicht meines Mantels mitsamt seinem Inhalt lastet jetzt wieder auf meinen Schultern. Es ist ein seltsames Gefühl, diesen Mantel zu tragen. Oft bin ich damit Zielscheibe für Fragen, auf die ich keine Antworten habe, oder für Bitten und Hoffnungen, die ich nicht erfüllen kann. Gleichzeitig fühlt er sich an wie mein Kokon, eine Schicht zwischen mir und der Außenwelt, die mir gerade so viel abverlangt.
Jetzt habe ich vergessen, für Herrn T. Rezepte auszustellen. Er hat seine Medikamente nicht erhalten. Die OP von Herrn S. musste abgesagt werden, weil ich sie nicht angemeldet habe. Ich renne umher, bin gestresst. Es ist alles meine Schuld. Die Pflegekräfte beschweren sich über mich, meine Vorgesetzten sind unzufrieden.
Ich schrecke hoch. Es ist Nacht, ich habe schon wieder vom Krankenhaus geträumt. Herr T. und Herr S. schlafen wahrscheinlich gerade ruhig in ihren Patientenzimmern. Niemand braucht etwas von mir, denn es ist 3:30 Uhr, und ich sitze zu Hause in meinem Bett. In den letzten Tagen begleiten mich die Gedanken an meine Arbeit weit über die Arbeitszeit hinaus. Oft verstumme ich mitten im Gespräch mit Freunden, weil ich plötzlich das Gefühl habe, etwas in der Arbeit vergessen zu haben. Bisher habe ich jede Nacht vom Krankenhaus geträumt – und im Traum werden all meine Ängste wahr. Dort vergesse ich die wichtigen Dinge, versage bei jeder Aufgabe, und alles geht schief.
Doch im Krankenhaus merke ich jetzt, in meiner dritten Arbeitswoche, wie ich Fragen oder Bitten, die auf mich zufliegen, besser annehmen und beantworten kann. Ich lege mir Strategien zurecht und lerne: Bei Fragen der Pflege hilft oft die Nachfrage: ›Wie macht ihr es denn normalerweise?‹ Oft wissen die Pflegekräfte in ihrer jahrelangen Erfahrung schon, wie man das Problem löst. Immerhin arbeiten manche schon länger in diesem Haus, als ich auf der Welt bin.
Im Umgang mit Patienten hilft es oft zu erklären, was ich bei der Untersuchung sehe, das beruhigt die meisten. Wenn ich etwas nicht weiß, hilft der Satz: ›Das muss ich besprechen‹ oder ›Das muss ich nachlesen‹. Oft genug bespreche ich ›das‹ mit mir selbst oder mit dem Computer. Wenn das nicht funktioniert, muss ich tatsächlich die Ärztin oder den Arzt fragen, die oder der für mich zuständig ist. Ich bin froh, diese Möglichkeit zu haben – eine Art Welpenschutz. Denn ich kenne ein System, in dem das anders läuft.
Einige meiner Kommilitonen aus Deutschland haben ebenfalls gerade angefangen zu arbeiten. Eine Freundin erzählte mir neulich, dass sie nach nur zwei Wochen allein für 20 Patienten verantwortlich war und nach drei Wochen als Assistenzärztin ihren ersten Wochenenddienst allein bestreiten musste. Ich schwieg und verspürte ein seltsames Schuldgefühl, weil ich weniger leiden muss. Denn ich habe meine Laufbahn mit der Basisausbildung begonnen. Die gibt es in Deutschland nicht, weshalb junge Ärztinnen und Ärzte dort von Anfang an dieselbe Verantwortung tragen wie erfahrene Kollegen.
Doch die Basisausbildung ist nicht unumstritten. Häufig klagen Jungärzte über mangelnde Betreuung oder darüber, dass sie hauptsächlich mit bürokratischen Aufgaben betraut werden, anstatt wertvolle praktische Erfahrung zu sammeln. Kritisiert wird auch der begrenzte Wissenszuwachs in dieser Zeit. Viele empfinden sie als ein verpflichtendes Hindernis, das sie ausbremst. Zusätzlich herrschen in Ballungsgebieten lange Wartezeiten auf einen Ausbildungsplatz.
Oft wird deshalb eine Abwanderung von Jungärzten ins Ausland befürchtet. Denn Migration ist unter Ärzten nicht selten: Österreichische Ärzte migrieren am häufigsten nach Deutschland und in die Schweiz. Im Jahr 2023 arbeiteten nahezu 3.000 Ärztinnen und Ärzte aus Österreich in Deutschland und knapp 2.500 in der Schweiz. Umgekehrt stammen aber auch etwa 3.000 der insgesamt etwa 50.000 Ärztinnen und Ärzte in Österreich aus Deutschland.
Am nächsten Tag geht die Arbeit auf der Station weiter im üblichen Galopp. Wieder werde ich angerufen, zwei Patienten brauchen noch Blutentnahmen. Eine Routineaufgabe, die aber viel Zeit frisst. Ich scanne mit dem Blick meine To-do-Liste, um auszumachen, welche der Aufgaben gerade Priorität hat, und entscheide mich für die Blutentnahmen. Also heißt es Stauschlauch anlegen, tasten, ein Stich, und schon rinnt das Blut mit einem dünnen Strahl in das Röhrchen. Während ich ein Röhrchen nach dem anderen fülle, fällt mir ein, dass ich diese Aufgabe in meinem Klinisch-Praktischen Jahr oft für die Assistenzärzte erledigen musste. Ich merke, dass ich Aufgaben delegieren muss, aber das fühlt sich ungewohnt an. Denn das Einzige, was ich bisher delegiert habe, war das Staubsaugen an meine WG-Mitbewohnerin, wenn ich Klausurenphase hatte. Und dabei hatte ich eher mäßigen Erfolg.
Doch nun wird mir klar, dass ich in dem Strom an Aufgaben untergehen werde, wenn ich nicht lerne, die Ressourcen richtig zu nutzen. Bei der nächsten Blutentnahme bitte ich deshalb einen Medizinstudenten, der gerade bei uns sein Praktikum macht, die Aufgabe zu erledigen. Mir fällt auf, dass ich einige organisatorische Telefonate an unsere Stationssekretärin weitergeben kann. Und bei Fragen zu Medikamenten die Pflegekräfte stärker miteinbeziehen muss. Das gibt mir mehr Zeit für die wichtigsten Aufgaben.
Einige Tage später sagt mir eine Pflegekraft am Morgen: ›Herr S. hat Fieber.‹
›Dann braucht er einen Rachenabstrich und eine Blutentnahme, um den Rest kümmere ich mich‹, antworte ich. Vor meinem inneren Auge poppt eine Checkliste auf: Punkte, die abgearbeitet werden müssen, um die Ursache des Fiebers zu finden. Das ist neu! Noch vor einigen Tagen hätte mich die Situation in Aufregung versetzt. Nervös hätte ich nach Ansprechpartnern gesucht. Jetzt hingegen notiere ich mir ›Fieber-Abklärung – Herr S.‹ auf meiner To-do-Liste, um später die nötigen Untersuchungen anzumelden.
Später am Tag möchte eine Patientin vorzeitig das Krankenhaus verlassen. Es ist meine Aufgabe, noch einmal mit ihr zu sprechen. Ich hole einen Stuhl, setze mich zu ihr und erkläre mit ruhiger Stimme: ›Ich verstehe, dass Sie nach Hause möchten. Aber zu Ihrer Sicherheit würden wir Sie gerne noch dabehalten.‹
›Naja, Spaß macht das hier wirklich nicht‹, gibt sie zurück. ›Glauben Sie mir, wir behalten Sie auch nicht aus Spaß hier. Es geht um Ihre Gesundheit. Es ist zu Ihrem Besten.‹
›Ich verstehe, dann bleibe ich noch da‹, sagt sie. Das lief erstaunlich gut! Ein Funken Freude regt sich in mir. Langsam lerne ich, in dem Strom mitzuschwimmen, statt mich mitreißen zu lassen. In meinem Kopf wird es ruhiger, es kehrt Struktur ein. Mein Mantel fühlt sich leichter an. Ein kurzer Blick in die Manteltaschen, der Hausrat ist an Ort und Stelle. Es ist etwas anderes, das fehlt: die Last auf meinen Schultern. Diese Mischung aus Angst und Überforderung, die mein ständiger Begleiter war. So gewinne ich Tag für Tag an Sicherheit – bis mein erster Arbeitsmonat als Ärztin so plötzlich vorbei ist, wie er begonnen hat.
An diesem Abend bin ich bereits seit neun Stunden in der Klinik. Eine Patientin stellt sich mit Halsschmerzen vor, ich untersuche sie, äußere meinen Verdacht und weise sie darauf hin, dass ich mich noch mit meinem Kollegen rückbesprechen muss, bevor ich sie entlassen kann.
Unvermittelt fragt sie: ›Wann kommt denn jetzt der Arzt?‹ Ohne nachzudenken antworte ich ihr: ›Ich bin der Arzt.‹
Am nächsten Morgen merke ich auf dem Weg zur Arbeit um 6:40, wie meine Angst ganz normaler Müdigkeit gewichen ist. In mein Leben ist eine neue Normalität eingekehrt. Ich bin bestimmt noch nicht für alles gewappnet, ich muss weiterhin viel fragen und brauche Unterstützung. Gleichzeitig habe ich viel gelernt und Überlebensstrategien entwickelt. Und in den letzten Nächten habe ich immer weniger vom Krankenhaus geträumt. •