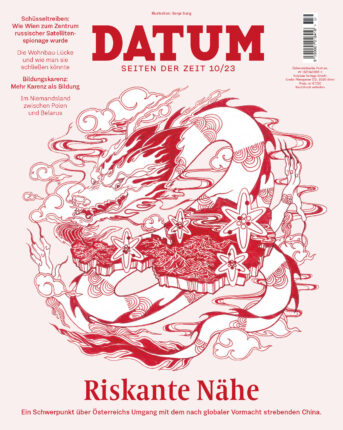Welche Zukunft hat die ÖVP?
Das hat datum den ÖVP-Europa-Abgeordneten Lukas Mandl, die Innenpolitik-Journalistin Barbara Tóth und den Politikwissenschaftler Fabio Wolkenstein gefragt. Ein Gespräch über den Umgang mit großen Traditionen, erstarkten Rechten und den langen Schatten von Sebastian Kurz.
Wir sitzen hier im ehemaligen Büro von Leopold Figl, Mitbegründer der Österreichischen Volkspartei nach dem Zweiten Weltkrieg. In seiner Weihnachtsansprache als erster Bundeskanzler der Zweiten Republik soll er inmitten der größten Not und Armut die Bitte geäußert haben: ›Glaubt an dieses Österreich‹. Diesen Satz holt der heutige ÖVP-Chef und Bundeskanzler, Karl Nehammer, ins Zentrum seiner politischen Kommunikation. Ist das eine adäquate historische Referenz?
Lukas Mandl: Mich berührt und motiviert dieser Satz sehr. Ich finde auch, dass er sehr gut zu Bundeskanzler Nehammer passt, weil man bei ihm spürt, dass es ihm eine Ehre ist, der Republik zu dienen.
Barbara Tóth: Als politische Beobachterin sehe ich das eigentlich vor allem als untrügliches Zeichen dafür, dass wir uns schon im Wahlkampf für die nächste Nationalratswahl befinden. Die FPÖ führt in allen Umfragen, ihr Chef Herbert Kickl stilisiert sich als ›Volkskanzler‹ , und die Frage ist, wer sein Gegner in einem ›Kanzler-Duell‹ sein wird: SPÖ-Chef Andreas Babler oder eben Karl Nehammer. Mit der Verwendung des Figl-Zitats positioniert sich Nehammer als redlicher Landesvater, der auf das Land und seine Bevölkerung schaut. Ich halte das für eine kluge wahlstrategische Weichenstellung.
Fabio Wolkenstein: Es stimmt ganz sicher, dass sich Nehammer hier als geschichtsbewusst und in einer großen Tradition stehend positionieren möchte. Aber man sollte aufpassen, dass man es nicht übermäßig kontextualisiert, denn vielen ist der historische Zusammenhang von Figls Ausspruch gar nicht bewusst. In erster Linie ist es ein Satz, der ermutigend klingt. Die Situation, in der sich christdemokratische Parteien heute wiederfinden, ist natürlich nicht ansatzweise vergleichbar mit der Zeit Figls.
Mandl: Das Schöne an diesem Zitat ist doch: Es ist eigentlich das genaue Gegenteil von parteipolitisch. Es entspringt dem sogenannten Geist der Lagerstraße, als Menschen dieses Land gemeinsam aus den Ruinen des Zweiten Weltkriegs und nach den schrecklichen Verbrechen im Holocaust wieder aufbauten. Viele von ihnen – so wie Leopold Figl – waren selbst im Konzentrationslager, und die Erinnerung an die ›Lagerstraße‹ einte sie über die politischen Grenzen hinweg. Ebenso wie die Erfahrung aus der Ersten Republik, die vor allem am Misstrauen in der eigenen Bevölkerung gescheitert war. Und in diesem Punkt, nämlich der Frage, wie groß das Vertrauen der Bevölkerung in Staat und Politik ist, gibt es starke Parallelen zu heute, auch wenn die Rahmenbedingungen natürlich ganz anders sind. Es ist nachvollziehbar und legitim, dass so etwas als parteipolitisch und wahltaktisch gesehen wird, aber ich kenne Karl Nehammer lange genug, um zu wissen, dass das authentisch ist.
In diesem Herbst kämpft Nehammer auch mit seinem Vorgänger als ÖVP-Chef, Sebastian Kurz, um Aufmerksamkeit. Der ist im Vorfeld seines Prozesses wegen falscher Zeugenaussage vor dem Untersuchungsausschuss im Parlament medial sehr präsent, über Filme, Interviews und so weiter. Wie ordnen Sie das ein? Alles nur Litigation-PR oder gekränkte Eitelkeit? Oder ist es der ÖVP nicht gelungen, aus Kurz’ Schatten herauszutreten und das letzte Kapitel Kurz noch nicht geschrieben?
Mandl: Mich amüsiert diese ganze Aufregung ein bisschen, und es ist ohnehin ganz wichtig, den Humor nicht zu verlieren. Und es ist politisch viel weniger relevant, als viele glauben.
Aber einer geordneten politischen Arbeit kann das ja nicht dienlich sein?
Mandl: Sebastian Kurz ist offenbar eine Person, die auf viele Menschen faszinierend wirkt. Das ändert aber nichts daran, dass wir einige wirklich große Krisen zu bewältigen haben und alle im politischen System aufgefordert sind, sich diesen Themen zu widmen und nicht bei Spielchen mitzuspielen, wo es vor allem um Eitelkeiten geht, und damit meine ich nicht den Protagonisten der zahlreichen neuen Kinofilme, sondern uns alle. Ich halte es mit Eleanor Roosevelt, die sagte: ›Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people.‹ Ich will niemandem unterstellen, ein kleiner Geist zu sein, aber die Logik unserer medialen Öffentlichkeit führt dazu, dass wir sehr viel mehr über einzelne Personen sprechen als über Ideen und Konzepte.
Tóth: Sebastian Kurz ist Unternehmer, Influencer, wenn man so will, und daher will er vor allem eines: im Gespräch bleiben. Und ja, es sagt viel über unsere Medienöffentlichkeit aus, dass er damit so erfolgreich ist. Aber es sagt auch etwas über die ÖVP aus. Als Historikerin sehe ich sehr deutlich, dass die ÖVP mit dieser sehr intensiven Ära Kurz noch nicht abgeschlossen hat. Es gibt keine gemeinsame Erzählung, keine historische Aufarbeitung.
Mandl: Also in meiner täglichen politischen Arbeit erlebe ich das nicht als Problem. Aber natürlich wird das von politischen Mitbewerbern gerne so stilisiert.
Wolkenstein: Es ist offensichtlich, dass Sebastian Kurz sehr stark für den zunehmenden Trend der Personalisierung in der Politik steht, der in den meisten Ländern und bei vielen Parteien zu sehen ist. Diese Personalisierung geht natürlich auf Kosten der Parteien selbst.
Ihr 2022 erschienenes Buch ›Die dunklen Seiten der Christdemokratie‹ trägt den Untertitel: ›Geschichte einer autoritären Versuchung‹. Inwiefern ist die ÖVP unter Kurz dieser Versuchung erlegen?
Wolkenstein: Was auf jeden Fall sehr deutlich zu erkennen ist, war der Rückgang der innerparteilichen Demokratie, also das Aussetzen beziehungsweise das bewusste Umgehen von Parteistrukturen, womit das Prinzip der ›Checks and Balances‹ bis zu einem gewissen Grad ausgehebelt wurde. Das ist eine Tendenz, die wir in sehr vielen Parteien sehen, aus allen Bereichen des politischen Spektrums. Dabei besteht immer die Gefahr, dass sich kleine Gruppen rund um die Führungspersönlichkeit über demokratische Spielregeln hinwegsetzen, Gremien nicht mehr konsultieren oder Institutionen delegitimieren. Das haben wir auch in der Sprache von Sebastian Kurz gesehen, etwa gegenüber dem Parlament oder der Justiz. Insofern gab es definitiv eine Stoßrichtung hin zu mehr Zentralismus und autoritärer Herangehensweise.
Tóth: Wenn wir uns anschauen, was in der türkis-blauen Regierung vor dem Platzen der Ibiza-Bombe passiert ist, kann man ganz eindeutig eine Stoßrichtung mit illiberalen autoritären Tendenzen erkennen. Es wurde die Beamtenschaft über weite Strecken ausgehebelt, es wurde der ORF in Frage gestellt oder die Justiz.
Mandl: Da habe ich eine ganz andere Wahrnehmung. Kurz hat oft ganz deutlich gesagt, dass Österreich eine liberale Demokratie bleibe, auch in Abgrenzung zu Ungarn unter Viktor Orbán. Und weil Sie den ORF angesprochen haben: Aus Vier-Augen-Gesprächen mit dem damaligen Medienminister Gernot Blümel weiß ich, dass ihm eine gute Zukunft für den ORF sehr wichtig war. Kritikwürdig ist eher der Karrierismus, der im Umfeld geherrscht hat, nicht nur von Kurz, sondern rund um die Regierung insgesamt. Die Politik eignet sich nämlich nicht für Karrierismus. Wer das glaubt, wird die tatsächliche Dimension und Bedeutung von staatlichem Handeln nie verstehen. Das hat nichts mit Ideologie zu tun, sondern das ist etwas Habituelles. Und dieser karrieristische Habitus hat dazu beigetragen, dass Fehler passiert sind. Ich meine damit niemanden in einem politischen oder gewählten Amt, sondern die Vorstellung unter Mitarbeitenden, auf einer Erfolgswelle mitschwimmen zu können.
Wolkenstein: Das ist bestimmt auch ein Merkmal dieses neuen Politikertypus, den wir ja schon mit Karl-Heinz Grasser kennen gelernt haben: Wenn vor allem die Ambition, Macht und Wahlen zu gewinnen, überwiegt, nicht aber ein gefestigtes Weltbild, dann besteht die Gefahr, dass man sich über demokratische Regeln hinwegsetzt oder Grenzen zumindest ausreizt, weil es Stimmen bringt. Das ist extrem gefährlich, weil man riskiert, sich von anderen vor ihnen hertreiben zu lassen und selbst keine Grenzen kennt. Die unterschiedlichen Positionen, die Sebastian Kurz in seiner politischen Karriere zum Thema Migration und Integration vertreten hat, sind dafür ein glänzendes Beispiel.
Zuletzt wurden immer öfter Vergleiche mit der Democrazia Cristiana laut, die von Korruptionsskandalen gebeutelt Mitte der 90er-Jahre zerfiel. Sie alle befassen sich intensiv mit der Christdemokratie – hat ihr österreichischer Ableger im 21. Jahrhundert noch eine Zukunft?
Wolkenstein: So wie alle großen Parteien, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, hat natürlich auch die Christdemokratie eine enorme Transformation durchgemacht. Die große historische Leistung der Christdemokratie war es ja, sehr heterogene gesellschaftliche Gruppen unter einem Dach zu vereinen. Im Wesentlichen sind es drei gesellschaftliche Elemente – das Liberale, das Konservative und das Christlich-Soziale. Dazu kam eine sehr starke Verwurzelung im ländlichen Raum, in den Gemeinden, über die Kirche, Arbeitnehmervertretungen und andere sogenannte intermediäre Organisationen. Diese breite gesellschaftliche Einbindung ist – genauso wie bei der Sozialdemokratie – schwächer geworden. Diese Grundidee, dass man also viele heterogene Gruppen integriert und ihre Interessen zusammenführt, hat, glaube ich, nichts an Relevanz verloren, allerdings hat die Christdemokratie mit dem Dilemma umzugehen, dass ihre ursprünglichen Milieus nicht mehr in der Form wie früher existieren.
Tóth: Das mag aus meinem Mund jetzt unerwartet klingen, aber ich bin ja eigentlich ein Riesenfan der ÖVP. Sie ist eine geniale Idee, weil sie auf dem Papier die unterschiedlichsten Gruppen vereint, eigentlich die perfekte Zentrumspartei. Und sie hatte bereits visionäre Ideen, wie die ökosoziale Marktwirtschaft. Aber auf diese Dinge, die in ihrer Veranlagung stecken, besinnt sich die ÖVP heute viel zu wenig.
Mandl: Karl Nehammer tut das.
Tóth: Wieso ernennt er dann Österreich zum Autoland?
Mandl: Weil es so ist – weil die Autozulieferindustrie eine wichtige Quelle unseres Wohlstandes ist.
Tóth: Aber das verändert sich gerade. Unter Sebastian Kurz hat die ÖVP versucht, die höflichere FPÖ zu sein. Es war ein Fehler von historischem Ausmaß, sich als Zentrumspartei einem rechtspopulistischen Herausforderer anzunähern. Die Aufgabe von Zentrumsparteien ist es, sich klar gegenüber den radikalen Rändern abzugrenzen.
Mandl: Ich finde den Begriff Zentrumspartei sehr passend, noch besser finde ich: soziale Integrationspartei. Das ist für mich die kürzestmögliche Beschreibung, worum es bei der ÖVP geht. Klaus Welle, der langjährige Generalsekretär des Europaparlaments mit CDU-Wurzeln, hat gesagt: ›Die Christdemokratie hatte seit 1945 eigentlich nur drei Ideen: die europäische Integration, die transatlantische Zusammenarbeit und die ökosoziale Marktwirtschaft.‹ Das war zwar süffisant, aber am Punkt. Und es hilft, sich darauf immer wieder zurückzubesinnen, dann stellt sich nämlich auch die Frage nicht, wer für die europäische Integration ist, wer für die ökosoziale Marktwirtschaft steht, trotz aller Herausforderungen, die dieser hohe Anspruch mit sich bringt. Und dann stellt sich auch nicht die Frage, wer für die transatlantische Zusammenarbeit steht. Es tat mir weh zu sehen, dass neben der gesamten FPÖ auch SPÖ-Abgeordnete bei der Rede von Präsident Selenskyj den Plenarsaal im Parlament verließen. Das meine ich nicht parteipolitisch, es tat mir weh fürs Land.
Tóth: Es wäre schön, wenn sich die ÖVP dieser Werte wieder besinnt und die Ära Kurz hinter sich lässt. Und da ist für mich die Frage essentiell, wie man mit dem rechtsextremen Rand umgeht. In Deutschland gibt es dazu eine breite Diskussion, die so genannte Brandmauer von CDU und CSU bröckelt. Von ÖVP-Chef Nehammer hört man dazu nur, keine Koalition mit Kickl. Aber ohne Kickl schon?
Mandl: Wenn ich da an Franz Vranitzky erinnern darf, der historische Verdienste erworben hat, etwa indem er die SPÖ auf EU-Kurs gebracht hat. In seiner Ausgrenzungspolitik gegenüber der FPÖ und Jörg Haider war er aber nicht erfolgreich, im Gegenteil: Der damalige Profil-Chefredakteur Hubertus Czernin hat ihn den ›Haider-Macher‹ genannt. Ich will das nur konstatieren, nicht interpretieren. Dessen muss man sich bewusst sein, wenn man über strategische Entscheidungen betreffend den Umgang mit der FPÖ spricht. Dazu kommt, dass sich unsere Öffentlichkeit komplett verändert hat: Befeuert durch die Algorithmen der Sozialen Netzwerke entstehen Echokammern, in denen sich Verschwörungsmythen, Hassideologien verbreiten und in denen gezielt Ängste geschürt werden. In dieser neuen Realität – und das bringt uns wieder zu Leopold Figl – brauchen wir ein Miteinander der konstruktiven Kräfte, eben diesen Geist der Lagerstraße. Im Europäischen Parlament erlebe ich diesen gemeinwohlorientierten Ansatz über Parteigrenzen hinweg sehr oft.
Tóth: Aber das ist ja ein bisschen das urösterreichische Dilemma: Dem Geist der Lagerstraße entspricht die große Koalition und die Sozialpartnerschaft.
Mandl: Ich maße mir nicht an, zu wissen, was heute dem Geist der Lagerstraße entspricht, aber eines weiß ich: Wir brauchen ein politisches Projekt, das zusammenführt. Das letzte große parteiübergreifende Projekt war der EU-Beitritt. Nur Herbert Kickl und die FPÖ zu verhindern, wird zu wenig sein. Wobei für mich Kickl als Bundeskanzler nicht infrage kommt, das muss ich so klar aussprechen. Und ich nehme entsetzt zur Kenntnis, wie er die FPÖ weiter verengt, mit der mehr als fragwürdigen Zusammenarbeit mit der AfD und haarsträubenden Botschaften. Aber solange Wahlen in Österreich so verlaufen, wie sie es tun, ist die FPÖ ein relevanter Faktor.
Tóth: Aber denken Sie, die FPÖ wäre ohne Kickl eine andere Partei?
Mandl: Sie war schon einmal eine andere, zum Beispiel unter Norbert Steger, und es wäre dem Land zu wünschen, dass sie es wieder wird. Auch die Entwicklung bei der SPÖ ist genau zu beobachten. Wir erleben ja nicht nur einen Rechtsruck bei der FPÖ, sondern auch einen Linksruck bei der SPÖ.
Tóth: Ich glaube, diesen Satz werden wir im Wahlkampf noch ganz oft hören.
Mandl: Aber bitte gestehen Sie mir zu, dass das für mich nicht ein simples Wording ist, sondern mein voller Ernst, meine Wahrnehmung.
Herr Wolkenstein, wie beobachten Sie die Diskussion in Deutschland über die bröckelnde Brandmauer der konservativen Union aus CDU und CSU gegenüber der AfD?
Wolkenstein: Es herrscht in Deutschland einfach eine andere Situation. Die AfD ist dort bei Weitem noch nicht so normalisiert wie bei uns die FPÖ, die erstens schon lange als Akteur dabei ist, auch schon mehrfach in der Regierung war und die ja sehr unterschiedliche Phasen erlebt hat. Der Umgang von CDU und CSU ist derzeit noch nicht wirklich umstritten, aber es gibt immer mehr vereinzelte Stimmen, die eine Annäherung sehen. Auch die Werteunion, eine konservative Gruppierung innerhalb der CDU und CSU, hat sich bereits zu manchen Themen so explizit geäußert, dass sie sich eigentlich auf einer Linie mit der AfD befindet und große Sympathien für Viktor Orbán hegt. Es gibt also Akteure, die überhaupt keine Berührungsängste spüren. Es war schon in der Vergangenheit eine Herausforderung für die Christdemokratie, dass sie teilweise in Gesellschaftsgruppen hineinreicht, die traditionell demokratiefeindlich waren. In ihrer Geschichte ist die Christdemokratie manchmal den Weg der klaren Abgrenzung und manchmal den Weg der Integration gegangen. Heute muss sich eine christdemokratische Partei dieser Frage ernsthaft stellen: Bis wohin kann ich ein rechtes Milieu integrieren, und wo verlaufen unsere roten Linien, wo dann Schluss ist.
Mandl: Ich bin – so wie viele Kolleginnen und Kollegen bei CSU und CDU – erschüttert über die hohen Umfragewerte der AfD, besonders in Ostdeutschland. Es gibt kein Patentrezept, zumindest kenne ich keines. Was wir tun können, ist: konstruktiv, kreativ, integrativ und hart arbeiten und gerade in so polarisierten Zeiten das Gespräch auch mit jenen suchen, deren Meinungen auf Basis von Evidenz und Hausverstand mitunter schwer erträglich sind. Das ist, was wir beitragen können. Und das betrifft genauso den Umgang mit dem Linkspopulismus, der auch in Österreich auf dem Vormarsch ist. Offenbar gibt es auch gegenüber dem Kommunismus kein historisches Bewusstsein mehr, da ist in der politischen Bildung einiges zu kurz gekommen.
Auch die Christdemokratie ist mit Gräben in den eigenen Reihen konfrontiert, etwa jenem zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Wie kann sie die überwinden?
Mandl: Auch da gibt es kein Patentrezept, was aber dafür jedenfalls notwendig ist, ist, sich seiner Werte bewusst zu sein: Die Christdemokratie lebt einen ethischen Anspruch, keinen religiösen oder gar konfessionellen. Es geht im Kern um die Würde des Menschen in der Tradition des jüdisch-christlichen Weltbildes. Und Robert Schuman, einer der Gründerväter der europäischen Christdemokratie und der Europäischen Union, hat auf die Frage, was einen christlichen Politiker ausmache, gesagt: erstens, den Humor bewahren. Zweitens, die Schläge, die man bekommt, nicht zurückgeben. Und, drittens, ›dédramatiser‹ auf Französisch, also entdramatisieren. Diese Mahnung nach mehr Gelassenheit ist heute besonders aktuell. •
Barbara Tóth ist Historikerin, Buchautorin und Journalistin bei der Wiener Wochenzeitung Falter. Gemeinsam mit ihrer dortigen Kollegin Nina Horaczek schrieb sie 2018 das Buch ›Sebastian Kurz – Österreichs neues Wunderkind?‹
Lukas Mandl ist seit 2017 Abgeordneter im Europäischen Parlament als Teil der ÖVP-Delegation. Von 2008 bis 2017 saß der gebürtige Wiener Abgeordnete im niederösterreichischen Landtag.
Fabio Wolkenstein ist Politikwissenschaftler und lehrt und forscht als Assoziierter Professor am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien. 2022 veröffentlichte er sein Buch mit dem Titel ›Die dunkle Seite der Christdemokratie‹.