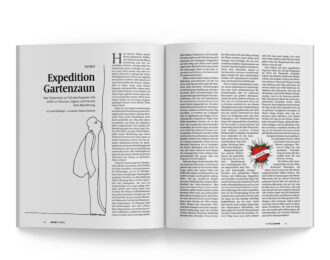Die Lawine
Für Tirols ewiges Transitproblem gibt es viele Lösungen. Warum funktioniert keine?
Lukas Scheiber sitzt im Auto. Er fährt auf der A12, der Tiroler Inntalautobahn, wie meist auf der linken Spur. Von Obergurgl, auf 1.907 Meter Seehöhe im Süden des Tiroler Ötztals, wo Scheiber ein 4-Sterne-Hotel betreibt, nach Ebbs bei Kufstein wird Scheiber zwei Stunden unterwegs sein. 186 Kilometer ist die Strecke lang. Spätestens ab Innsbruck, ab dem Anschluss zur Brennerautobahn, wird der Verkehr auf der Inntalautobahn zäh. Die rechte Spur gehört den Sattelschleppern, die Überholspur den Autos. 100 km/h dürfen sie hier fahren. Der so genannte ›Lufthunderter‹ wurde 2014 eingeführt, um die Schadstoffbelastung durch den Verkehr zu reduzieren. Wäre Scheiber heute nicht um 4 : 30 Uhr aufgestanden, würde er jetzt im Stau stecken. Er hat sich dem Tiroler Transitproblem angepasst: ›Ich verbinde auf der Strecke so viele Termine wie möglich und bin so wenig wie möglich auf der Straße. Man stellt den Tempomat ein und zuckelt dahin.‹ Der Railjet rast mit 220 km/h Höchstgeschwindigkeit parallel zur Autobahn. Für Scheiber sind öffentliche Verkehrsmittel jedoch keine Option. Zwischen drei und vier Stunden wäre er mit Bus und Zug von Obergurgl nach Ebbs unterwegs.
Durch Tirol führt der kürzeste Weg vom Norden in den Süden und die mit 1.370 Metern niedrigste Nord-Süd-Verbindung über den Alpenhauptkamm – der Brennerpass. Die Zählstelle in Schönberg am Brenner registrierte im Jahr 2017 2,25 Millionen LKW, die den Brenner überquerten, so viele wie nie zuvor. Im Jänner und Februar 2018 allein fuhren 16,7 Prozent mehr LKW über den Brenner als im Vergleichszeitraum 2017. ›Die Grenze der Belastbarkeit ist definitiv erreicht‹, hielt der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter schon am 8. Jänner 2018 in einer Aussendung fest.
Wörter: 2243
Lesezeit: ~ 12 Minuten
Diesen Artikel können Sie um € 1,50 komplett lesen
Wenn Sie bereits Printabonnentin oder Printabonnent unseres Magazins sind, können wir Ihnen gerne ein PDF dieses Artikels senden. Einfach ein kurzes Mail an office@datum.at schicken.