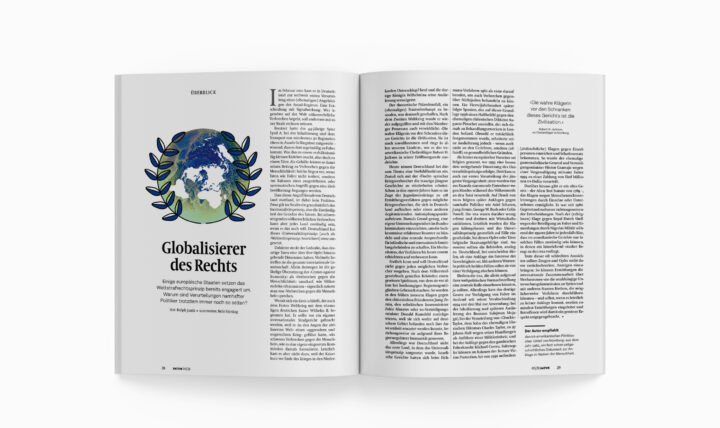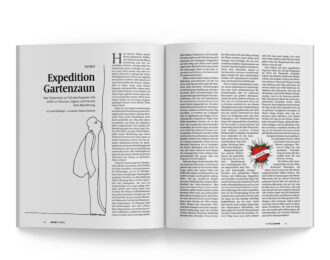Globalisierer des Rechts
Einige europäische Staaten setzen das Weltstrafrechtsprinzip bereits engagiert um. Warum sind Verurteilungen namhafter Politiker trotzdem immer noch so selten ?
Im Februar 2021 kam es in Deutschland zur weltweit ersten Verurteilung eines (ehemaligen) Angehörigen des Assad-Regimes. Eine Entscheidung mit Signalwirkung : Wer irgendwo auf der Welt völkerrechtliche Verbrechen begeht, soll anderswo mit einer Strafe rechnen müssen. Konkret hatte der 44-jährige Syrer Eyad A. bei der Inhaftierung und dem Transport von mindestens 30 Regimekritikern in Assads Gefängnisse mitgewirkt – wissend, dass es dort regelmäßig zu Folter kommt. Was ihn zu einem verhältnismäßig kleinen Rädchen macht, aber doch zu einem Täter. Als › Gehilfe ‹ leistete er damit seinen Beitrag zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit : Solche liegen vor, wenn Taten wie Folter nicht isoliert, sondern › im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen eine Zivilbevölkerung ‹ begangen werden.
Dass dieser Angriff fernab von Deutschland stattfand, ist dabei kein Problem. Zwar gilt im Strafrecht grundsätzlich das Territorialitätsprinzip, also die Zuständigkeit der Gerichte des Tatorts. Bei schwerwiegenden völkerrechtlichen Verbrechen kann aber jedes Land zuständig sein, wenn es das auch will. Deutschland hat dieses › Universalitätsprinzip ‹ (auch als › Weltrechtsprinzip ‹ bezeichnet) 2002 umgesetzt.
Dahinter steckt der Gedanke, dass derartige Taten eine über ihre Opfer hinausgehende Dimension haben. Vielmehr betreffen sie die gesamte internationale Gemeinschaft. Allein deswegen ist die geläufige Übersetzung der › Crimes against humanity ‹ als › Verbrechen gegen die Menschlichkeit ‹ unscharf, wie Völkerrechtler oft monieren – eigentlich müsste man von › Verbrechen gegen die Menschheit ‹ sprechen.
Womit sich ein Kreis schließt, der nach dem Ersten Weltkrieg mit dem ehemaligen deutschen Kaiser Wilhelm II. begonnen hat. Er sollte vor ein eigenes internationales Strafgericht gebracht werden, weil er › in den Augen der zivilisierten Welt ‹ einen › aggressiven und ungerechten Krieg ‹ geführt hatte, › ein schweres Verbrechen gegen die Menschheit ‹, wie es eine eigens eingesetzte Kommission damals formulierte. Letztlich kam es aber nicht dazu, weil der Kaiser kurz vor Ende des Krieges in den Niederlanden Unterschlupf fand und die dortige Königin Wilhelmina seine Auslieferung verweigerte.
Wörter: 1067
Lesezeit: ~ 6 Minuten
Diesen Artikel können Sie um € 1,50 komplett lesen
Wenn Sie bereits Printabonnentin oder Printabonnent unseres Magazins sind, können wir Ihnen gerne ein PDF dieses Artikels senden. Einfach ein kurzes Mail an office@datum.at schicken.
Sie können die gesamte Ausgabe, in der dieser Artikel erschien, als ePaper kaufen:
Bei Austria-Kiosk kaufen