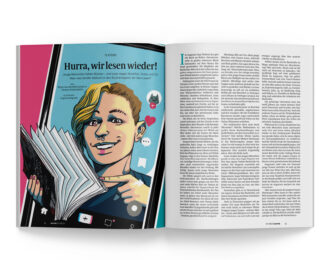An der Strippe
Was das Bild von Donald Trumps Anruf bei Marjorie Taylor Greene über die US-amerikanische Politik der Gegenwart verrät, erklärt Foto-Historikerin Cara Finnegan.
Die ultrakonservative Marjorie Taylor Greene streckt einem Parlamentskollegen ihr leuchtendes Smartphone entgegen. Es ist der Moment, den sie selbst später als ›den perfekten Anruf‹ bezeichnen wird. Ein Anruf, der dem bangenden Kevin McCarthy seine Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses sichert. Der erhellte Screen zeigt die Initialen des umstrittenen Gesprächspartners: DT.
›Obwohl Donald Trump nicht anwesend ist, befindet er sich doch im Raum‹, analysiert die Fotografie-Historikerin Cara Finnegan. Der Ex-Präsident gilt als Taylor Greenes politische Vaterfigur und taucht über deren Smartphone nun im Kongress-Saal auf. Im Moment der Aufnahme versucht Trump gerade, seine letzten rebellischen Parteikollegen von der Wahl McCarthys zu überzeugen.
Taylor Greene übernimmt die Rolle seiner Botschafterin und sticht als solche aus dem Foto heraus. ›Das Licht scheint herab und erleuchtet das Gesicht der Abgeordneten. Die Augen des Betrachters fallen so unweigerlich auf sie‹, sagt Finnegan. Die Erscheinung der Republikanerin erinnert die Wissenschaftlerin fast an biblische Engelsdarstellungen. In der dunklen Umgebung wirke die blonde Fundamentalistin wie eine Lichtgestalt, die auf ihrem Smartphone ein Machtwort aus der Abwesenheit übermittelt.
Den zweiten Blickfang des Fotos bildet der leuchtende Bildschirm ihres Smartphones. Finnegan sieht darin eine Metapher für die Übermacht technologischer Kommunikationsmittel in der Politik der Gegenwart: ›Alles, was wir heute tun, auch die Politik, ist über unser Smartphone vermittelt. Dort beginnt der Kampf, dort beginnt die Diskussion.‹
Der republikanische Abgeordnete, dem Taylor Greene das Telefon entgegenstreckt, heißt Matt Rosendale und ist ein Kritiker McCarthys. Bei den vorherigen Wahlgängen stimmte er konstant gegen ihn. Dementsprechend ist er auf dem Bild mit einer abweisenden Handbewegung gegenüber McCarthy zu sehen. ›Damit wollte er als jemand erscheinen, der sich nicht von Trump beeinflussen lässt‹, sagt Finnegan. Doch tatsächlich scheint der Ex-Präsident am Smartphone einen solchen Eindruck auf Rosendale zu machen, dass dieser seine Meinung ändert: In der anschließenden Runde stimmt der Republikaner für McCarthy und verhilft ihm damit zum Sieg.
›Das Bild zeigt, wie Trump selbst in seiner Abwesenheit die politischen Entscheidungen im Parlament beeinflusst, obwohl er überhaupt kein politisches Amt mehr bekleidet‹, sagt Finnegan. Die Wissenschaftlerin sieht in dem Foto das Abbild einer Bedrohung. Eine Warnung, ›welch enorme Wirkung die Trump-Ideologie auf die amerikanische Politik immer noch hat‹. Es mache deutlich, dass sein Vermächtnis in den Machtorganen der USA weiterlebe. Über treue Anhänger wie Taylor Greene habe Trump seine Kanäle direkt dorthin. Er ist eben nur einen Anruf entfernt. •