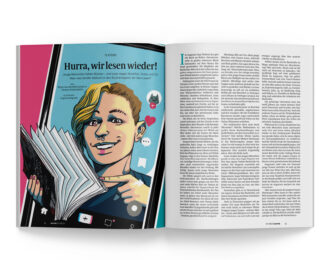Der Krieg auf Schienen
Vor knapp einem Jahr wurde Oleksandr Kamyschin Chef der ukrainischen Bahn. Jetzt muss er Flüchtlingszüge und Hilfstransporte organisieren – und eine globale Hungersnot verhindern.
Langsam nähert sich der Zug aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew dem 30 Kilometer entfernten Bahnhof Irpin. Kurz bevor die Gleise auf einer mächtigen Stahlgitterbrücke den gleichnamigen Fluss queren, hält der blau-gelb lackierte Dieseltriebwagen auf freier Strecke und öffnet die Türen. Oleksandr Kamyschin springt als erster hinunter auf den Bahndamm. Dass der 38-jährige Kamyschin mit der Staatsbahn ›Ukrzaliznitsja‹ das größte Staatsunternehmen der Ukraine leitet, mit 260.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 150 Millionen Passagieren pro Jahr, sieht man ihm an diesem heißen Junitag nicht an.
Der großgewachsene Mann mit dem markanten Kinnbart trägt ein schwarzes T-Shirt, die Haare hat er zu einem Zopf gebunden. Hinter Kamyschin springen junge Männer im selben Dresscode aus dem Zug. Sie sind die neue Führungscrew der Staatsbahn. Gemeinsam mit ihrem Boss sind sie im Sonderzug nach Irpin gefahren, um die Schäden an der Strecke und deren Reparatur vor Ort zu inspizieren. Denn das Funktionieren der Bahn ist für die Ukraine in diesen Kriegstagen überlebenswichtig.
Der Name des Kiewer Vororts ›Irpin‹ steht neben ›Butscha‹ für die schlimmsten Gräueltaten der russischen Armee. Putins Soldaten nahmen den nördlichen Teil der Kleinstadt Anfang März ein, zerstörten die Wohnhäuser und massakrierten die Zivilbevölkerung. Um den russischen Vormarsch auf Kiew zu stoppen, sprengte die ukrainische Armee die Eisenbahn- und Straßenbrücken über den gleichnamigen Fluss. Anfang April zogen die Russen aus Irpin ab und hinterließen eine Stätte des Grauens.
Während die Toten der Stadt mittlerweile bestattet sind, werden die Zerstörungen von Gebäuden und Infrastruktur noch lange zu sehen sein. Einen Monat lang war die zweigleisige Bahnstrecke überhaupt nicht befahrbar. Seit Mitte Mai ist zumindest ein Gleis wieder frei. ›Experten sagten uns, der Wiederaufbau einer zerstörten Brücke sei eine Frage von Monaten‹, sagt Bahnchef Oleksandr Kamyschin und zeigt mit sichtbarem Stolz auf einen provisorischen Brückenpfeiler aus Stahlrohren: ›Wir haben es in 30 Tagen geschafft.‹ Dann steigt er über Schutthalden hinunter zum Flussufer, unterhält sich mit den Bahnarbeitern, klopft dem Vorarbeiter auf die Schultern: ›Er hier ist der wahre Held.‹
Wörter: 1984
Lesezeit: ~ 11 Minuten
Diesen Artikel können Sie um € 3,50 komplett lesen
Wenn Sie bereits Printabonnentin oder Printabonnent unseres Magazins sind, können wir Ihnen gerne ein PDF dieses Artikels senden. Einfach ein kurzes Mail an office@datum.at schicken.