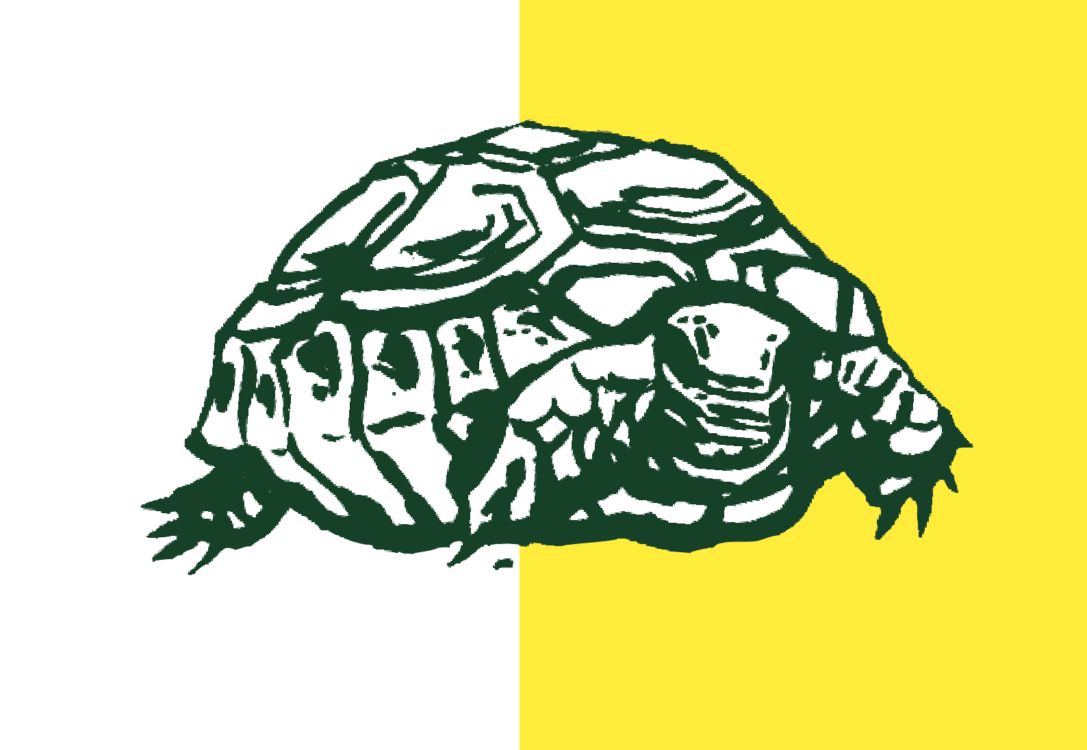Die Welt ist nicht genug
Weiter weg, schneller hin: Wie wir uns die Welt aneignen, ohne ihr dabei näher zu kommen.
Möglichst unauffällig wische ich die Armlehne ab, damit mein Sitznachbar nicht merkt, dass meine Hand dort Angstschweiß hinterlässt. Ich lese den Satz in meinem Lieblingsbuch jetzt schon zum vierten Mal, als endlich die Triebwerke beginnen, anzuschieben. Den Moment des Abhebens von der Startbahn empfinde ich tatsächlich als erhebend – zwar nicht erfreulich, aber doch bedeutsam. Die letzte Berührung mit Mutter Erde? Danach geht es für mich bergab, je steiler der Steigflug, je höher die Flughöhe. Nur das Landen ist noch schlimmer.
Ich habe Flugangst und sie begleitet mich lange. Es ist eine Art Ikarus-Urtrauma, mein ganz persönlicher Einspruch gegen diese Überheblichkeit: Warum bilden wir uns ein, uns derart über die Schwerkraft hinwegsetzen zu können? Einfach einzusteigen in diese Raumkapsel, die uns für ein paar Tage innerhalb lächerlich weniger Stunden wegbringt von hier? In Metropolen, nur einen Kulturschock entfernt? Sich dabei hinwegsetzend über Kriegsgebiete und Autokratien, über Weltmeere und Gebirgsketten? Eine Zeit lang hatte ich beruflich viele Flüge zu absolvieren, 20 bis 30 pro Jahr, davor jedesmal existenzielle Angst und Ungläubigkeit.
Nach dem Start darf ich dann – und wie viele durften das vor mir schon? – dieses unfassbare Über-den-Wolken-Sein erleben, der ewige Sonnenschein (wenn nicht im Erdschatten) überirdisch schön. Ich bin dabei so angespannt, als wäre ich eine Astronautin zwischen den Welten. Ich nehme zwei, drei kräftige Schluck vom eiskalten Rotwein, den mir die Stewardess in den Plastikbecher schenkt. Ein Bekannter riet mir einmal, ich solle mir doch mit diesem Bild behelfen: Das Flugzeug gleite auf Luftpolstern dahin, die ihm der Auftrieb unterschiebt. Ich aber sehe mich immer noch vor meinem geistigen Auge auf einem einzelnen Flugzeugsitz, der an dieser Maschine nur mit seidenen Fäden befestigt ist; wie durch eine Falltüre könnte ich mit ihm jederzeit aus zehn Kilometern Höhe senkrecht hinabstürzen, auf dem Weg an die US-Ostküste in den Nordatlantik, auf dem Weg nach Delhi in den Großen Kaukasus.
Selten fühle ich mich so von der Welt entfremdet wie am Flughafen und im Flugzeug. Und diese Entfremdung, das Abgefertigt-werden vor dem und das Ausgeliefertsein während des Fluges, empfinden auch viele, die gar nicht unter Flugangst leiden. Das Eigenartige dabei: Wir, die Wohlstandsgeprägten von heute, verhalten uns ja gerade deshalb so, setzen uns ja gerade deshalb Flughäfen und Flugzeugen aus, weil wir die Welt besser kennenlernen, sie erspüren, sie erfahren möchten. Wir wollen das unbedingt. Und die Flüge sind doch – wie andere Konsumgüter – verfügbar und wir liquide. Es ist möglich und legitim, für einen niedrigen Preis in eine europäische Stadt zu fliegen, jeder tut das heute. Selbst dann, wenn es uns überfordert, Stress verursacht oder so gar nicht zu einem gelungenen Leben beiträgt.
›Weltreichweitenvergrößerung‹ nennt der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa diesen Versuch. Das eigene Leben als gelingend zu empfinden – ob beim Essen, beim Kaufen, beim Reisen –, dieses Gefühl lässt sich nicht erzwingen. Der Versuch, es zu erreichen, birgt nämlich immer das Risiko der Unverfügbarkeit in sich: ›Das Schnurren der Katze kann ausbleiben, die Lieblingsmusik kann uns auch völlig kaltlassen, der Wald oder das Meer können uns jede Resonanz verweigern usw.‹, aber genau dieses Moment mache die Erfahrung, wenn sie dann einmal gelingt, so kostbar, sagt Rosa. Unter ›Resonanz‹ versteht er ein gemeinsames Schwingen von Individuum und Welt, eine ›antwortende, entgegenkommende‹ Beziehung, in der wir uns ›getragen oder sogar geborgen‹ fühlen. Wollen wir Resonanzerfahrungen kontrollieren oder ständig verfügbar machen, gehen sie daran kaputt.
Das kann auch beim Shopping passieren, weil das ›Kauferlebnis‹ heute nie unverfügbar ist – oder: war. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgrund des Coronavirus setzen nun der Verfügbarkeit von Konsumerfahrungen enge Grenzen (bzw. können sie größtenteils nur virtuell vermittelt stattfinden). Gibt diese Pause uns Gelegenheit, Resonanz neu zu entdecken?
Das Coronavirus zwingt uns zum Stehenbleiben. Zum Zuhausebleiben. Dazu, uns zu besinnen. Für viele von uns werden zum ersten Mal in ihrem Leben Freiheitsrechte beschnitten; ich kann mich in meiner Lebensspanne an Ereignisse dieser Tragweite nicht erinnern – bis auf die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, angesichts derer es für uns Kinder von damals auch hieß: Geht nicht ins Freie! Mich und meine Generation hat sonst stets die Ausdehnung unserer Weltreichweite geprägt: Ich wurde gemeinsam mit einer EU erwachsen, die keine Passkontrollen mehr von mir verlangte, ich war die erste in meiner Familie, die an einer Universität studierte, die erste, die auf einen anderen Kontinent reiste. Und jetzt schrumpft meine, unsere Welt zu einer Miniatur, unsere Existenz scheint plötzlich ernsthaft fragil. Ich sitze in meinen vier Wänden und in mir kommt die Frage hoch: Warum fühlen wir uns eigentlich so von der Welt entfremdet, wenn wir doch (vor Corona) ständig so vehement unsere Reichweite vergrößern wollten?
In den Geisteswissenschaften ist für diese Frage die ›praktische Philosophie‹ zuständig, die sich mit dem Handeln der Menschen in der Welt beschäftigt, die Ethik. In ihr gibt es (neben vielen kleineren Strömungen) zwei große Denkschulen, die erste ist der Utilitarismus. Stets auf den ›Nutzen‹ einer Handlung ausgerichtet, ist es das Modell, das mit unserem System der sozialen Marktwirtschaft am besten zusammenpasst. ›The greatest good for the greatest number of people‹, Nutzenmaximierung für alle Beteiligten also, forderte Jeremy Bentham, einer seiner Begründer; die Motive des Entscheiders spielen keine Rolle. Das klingt schön, fast demokratisch. Doch wen beziehen wir in die jeweilige Rechnung ein? Alle Österreicher? (Wer alles sind ›Österreicher‹?) Alle Menschen auf der ganzen Welt? Alle Lebewesen? Und die Pasterze, die Donau, der Regenwald, haben die nicht auch Interessen? Die besondere Berücksichtigung von Marginalisierten sieht der Utilitarismus nicht prinzipiell vor.
Wir glauben immer noch, die biblische ›dominion over nature‹ ausüben, also über natürliche Ressourcen herrschen oder jedenfalls verfügen zu können. Wir tun das in unserem Sinn. Wir treffen die Entscheidungen, weil wir die Freiheit haben zu entscheiden, über die Köpfe aller anderen hinweg, sie pauschalisierend: die Menschen im globalen Süden, die Umwelt, die Nutztiere. Die ›Qual‹ der Wahl brächte allerdings auch Verantwortung mit sich. Wer nimmt sie wahr?
Der Utilitarismus stiftet zur Egozentrik an: Wenn ich etwas möchte, wird sich innerhalb marktwirtschaftlicher Konditionen eine Gruppe finden lassen, die von meinem Begehren auch profitiert. Wer profitiert, wenn ich übers Wochenende nach Istanbul fliege? Die Fluggesellschaft samt Belegschaft (Arbeitsplatz, wenngleich zu schlechten Bedingungen, gesichert!) profitiert, Tourismus und Handel profitieren. Los geht’s! Es scheint, wir beziehen immer diejenigen in unsere Kalkulation ein, die wir darin gut gebrauchen können, um auf unsere Kosten zu kommen. Die, die nicht profitieren, werden einfach nicht berücksichtigt.
Mit Immanuel Kant – er begründete die zweite große ethische Denkschule neben dem Utilitarismus – fällt es schon leichter, sich die eigenen Grenzen bewusst zu machen, um die Interessen anderer mitzubedenken: Handle stets so, dass dein Handeln zum (für alle gültigen) Gesetz werden könnte. Utilitaristen könnten auch so rechnen: Hätte jeder Mensch dieser Welt die Möglichkeit, einmal im Jahr einen Wochenendtrip nach Istanbul zu machen, wäre das etwa eine Verdopplung des aktuellen Flugpassagieraufkommens.
Grund dafür, dass ich seit Sommer 2016 in kein Flugzeug mehr gestiegen bin, ist also nicht nur die Flugangst und meine stille Überzeugung von der Überheblichkeit des Menschen, sondern auch das Gefühl, dass unser Wohlstand auf Kosten anderer geht. Die Fridays-for-Future-Bewegung spiegelt dieses Unbehagen wider, Vegetarier und Veganer, Radfahrer und Mülltaucher. Sie haben etwas gemeinsam: Sie üben sich in einer Art freiwilliger Selbstbeschränkung. Sie wollen irritieren, indem sie verweigern, was viele als komfortabel anstreben: Fleischessen, Befördertwerden, Einkaufen, ein Einfamilienhaus bauen (was zu Zersiedelung und Bodenversiegelung beiträgt), Flugreisen, ein eigenes Auto und so weiter. Sie verzichten freiwillig – ob aus Sorge, aus Umwelt- oder Gesundheitsbewusstsein. Sie machen für sich etwas ständig Verfügbares zu etwas Unverfügbarem. Dient dieses Verzichten dem Zweck einer Selbstoptimierung oder wird gar zur Ideologie, der sich auch andere unterwerfen sollen, wird es instrumentalisiert. Der individuelle, freiwillige Verzicht hingegen bezeugt Solidarität mit allen, die vermeintlich ›komfortlos‹ leben (müssen).
Wie können wir also ethisch auf die Coronakrise reagieren? Utilitaristisch ist das schwierig, weil ihr Verlauf und ihre Folgen kaum absehbar sind. Wir Menschen spielen in diesem Geschehen nur eine kleine Rolle, sind quasi Passagiere, die versuchen, sich fürs Nötige zu wappnen. Viele Graphen bekamen wir in den vergangenen Wochen zu sehen, aber Natur verhält sich oft nicht der Prognose gemäß, sie wandelt sich ständig. Alle Lebewesen sind irritierbar, das wissen wir doch selbst. Und ein Virus gilt zwar – weil er keinen eigenen Stoffwechsel hat – nicht als Lebewesen, ist aber auch unberechenbar: Er kann mutieren.
Als Alternative könnten wir nach der Maxime handeln, einander möglichst viel Handlungsspielraum offen zu lassen, zuversichtlich und vorsorgend. Auch wenn das bedeutet, vorübergehend nicht vor die Tür zu gehen. In der Zwischenzeit könnten wir uns überlegen, wie für unsere Nachbarn, Menschen anderswo, für einen Koalabären oder den Regenwald ein gelungenes Dasein auf dieser Welt aussehen mag. Ist es nicht genau das, was uns als Menschen ausmacht: dass wir bewusst auf andere Rücksicht nehmen können?
Es heißt, wir lernen an unseren Versuchen, Krisen zu bewältigen. Ja? Dann erkennen wir in dieser Krise vielleicht, dass Verzichten neue Wege eröffnen kann. Vielleicht überwinden wir in ihr die Überheblichkeit. Vielleicht bringt uns die Krise zu einer Ethik, die nicht nur den Einzelnen in ihre Überlegungen einbezieht, nicht ethno- oder anthropozentrisch (also sich rein am Menschen beziehungsweise der eigenen Gemeinschaft ausrichtend) wirkt, sondern eine Ethik, die alles Leben als integrale Bestandteile eines Weltsystems begreift; denn was immer wir tun, wirkt – ganz unesoterisch – auf Umwegen auf unsere Existenz zurück. ›Resonanz ist kein Gefühlszustand, sondern ein Beziehungsmodus‹, stellt Rosa fest, und sie ist auch kein Produkt, sondern ein Prozess. Unsere Weltbeziehungen können gelingen – wenn wir es schaffen, uns die Welt anzuverwandeln, ohne sie dabei zu überwältigen.
Für mich jedenfalls gibt es für diesen Versuch geeignetere Orte als ein modernes Verkehrsflugzeug. •