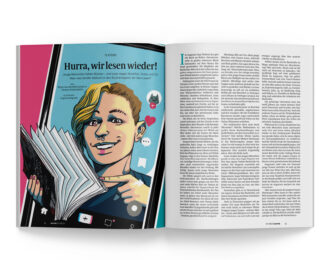Die Mauer im Sand
Seit über 40 Jahren kämpfen die Sahrauis um eine unabhängige Westsahara. Der Konflikt zehrt auch am inneren Zusammenhalt der Volksgruppe.
In der Nähe von Tindūf, am westlichsten Zipfel Algeriens, macht sich Ahmed Bashir bereit für den Krieg. Er küsst seinen jüngsten Sohn auf die Stirn und fährt in einem Jeep hinaus in die Wüste – vorbei an Ziegenherden und Checkpoints der algerischen Armee, vorbei an Kamelen und Müllhaufen aus Plastikkanistern und alten Gummireifen. Sein Ziel ist die Mauer. Sie hebt sich kaum erkennbar vom Wüstensand ab, gelber Stein auf gelbem Sand, links und rechts bis zum Horizont.
Ahmed Bashir steigt aus und beobachtet aus der Ferne seine Gegner, die nur als dunkle Schatten auf dem Bauwerk zu erkennen sind: marokkanische Grenzsoldaten. Die Mauer ist Bashirs Alptraum, sein ewiger Feind. Mehr als 2.500 Kilometer lang zieht sie sich durch die Wüste, bewacht von zehntausenden marokkanischen Soldaten, umgeben von einem Sandstreifen, der durchsetzt ist mit tausenden Landminen.
Die Mauer durchtrennt die Sahara, die größte Trockenwüste der Welt, und hindert Ahmed Bashir daran, an den Ort seiner Geburt zurückzukehren: in die Westsahara, eine Region von der Größe der alten Bundesrepublik Deutschland. Seit mehr als 40 Jahren hält Marokko sie besetzt.
› Ich stehe jeden Morgen auf und hoffe, wieder kämpfen zu können ‹, sagt der 52 Jahre alte Bashir. Der heiße Wind zerrt an den Enden seines Turbans und bläst ihm Sand ins Gesicht. Er hat das Warten satt. Wenn er dürfte, dann würde er sofort los und den Feind Stück für Stück aus seinem Land vertreiben. Doch Bashir ist zum Warten verdammt. 15 Jahre lang, von 1976 bis 1991, war die Region von einem Bürgerkrieg erschüttert. Dann, am 6. September 1991, ein Waffenstillstand. Unterzeichnet wurde er unter Aufsicht der UNO vom Königreich Marokko und der Frente Polisario, der politischen und militärischen Vertretung der Sahrauis, einer indigenen Gruppe, die die Westsahara als ihr Heimatland betrachtet.
Wörter: 2865
Lesezeit: ~ 16 Minuten
Diesen Artikel können Sie um € 3,50 komplett lesen
Wenn Sie bereits Printabonnentin oder Printabonnent unseres Magazins sind, können wir Ihnen gerne ein PDF dieses Artikels senden. Einfach ein kurzes Mail an office@datum.at schicken.