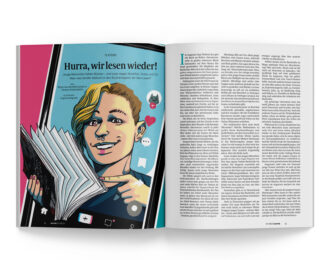Am 1. November 2017 zerren Sicherheitsbeamte Baqytali Nur am Hemdkragen von der Bushaltestelle am Grenzübergang Khorgos zwischen China und Kasachstan zur Seite und prügeln auf ihn ein. Seine Tochter Roza wird wütend und geht mit Fäusten auf einen Beamten los. Der Vater wird schließlich in eines der zahlreichen Umerziehungslager Xinjiangs gebracht. Im Laufe des nächsten Jahres wird er verhört und geschlagen, singt kommunistische Lieder, zitiert Konfuzius – und wird von einem kräftigen, gesunden zu einem kranken, gebrochenen Mann.
Er soll Verbindungen zu Terroristen haben, lautet der Vorwurf, den der chinesische Staat gegen ihn erhebt. Warum ist er so oft nach Kasachstan gereist? Wen er dort getroffen hat, wollen die Behörden wissen, und worüber sie sprachen. Immer wieder wird er diese Fragen hören. Im ersten, zehn Stunden lang dauernden Verhör nach der Festnahme, und später auf einem Foltersessel.
Baqytali Nur hat ihnen nicht viel zu sagen. Er war zum Zeitpunkt seiner Festnahme Kleinhändler, hatte Kartoffeln, Gurken und Kraut aus China in Kasachstan verkauft und von dort Süßigkeiten, Geschirr und Seifen zurück nach China gebracht.
Er ist ethnischer Kasache wie etwa anderthalb Millionen andere in Xinjiang auch. In der Uigurischen Autonomen Region Xinjiang im Südwesten Chinas leben mehr als 20 Millionen Menschen auf einer Fläche etwa 20 Mal so groß wie Österreich. Seit Jahrhunderten haben sich hier verschiedene Turkvölker angesiedelt. Zumeist sind es Uiguren, daneben Kasachen, Usbeken und Kirgisen. Es sind weitgehend muslimische Völker, vielfach traditionell nomadische Hirten, die ihre Religion einst aus Ländern wie etwa der heutigen Türkei mitbrachten.
Wörter: 2489
Lesezeit: ~ 14 Minuten
Diesen Artikel können Sie um € 3,50 komplett lesen
Wenn Sie bereits Printabonnentin oder Printabonnent unseres Magazins sind, können wir Ihnen gerne ein PDF dieses Artikels senden. Einfach ein kurzes Mail an office@datum.at schicken.