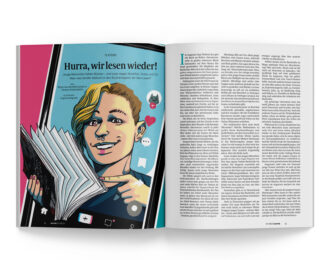Stadt mit zwei Gesichtern
Dschenin im Westjordanland gilt vielen Israelis als Rückzugsort für Attentäter. Für viele Palästinenser symbolisiert der Ort dagegen ihre Forderung nach echter Autonomie.
Die Ruhe in der Altstadt von Dschenin trügt. Auf dem jahrhundertealten Basar haben die ersten Cafés geöffnet, aus einer Bäckerei weht der Duft nach frisch gebackenem Fladenbrot. Doch in den schmalen Gassen kann sich die Situation jederzeit ändern. ›Jeden Moment kann die Armee kommen und plötzlich wird geschossen‹, erzählt Henna Haj Hassan. Die 29-Jährige mit dem roten Strickpullover steht vor der Musikschule Kamandschati, die in einem verwinkelten Haus aus sandfarbenem Kalkstein untergebracht ist. Eine alte Steintreppe führt in eine große Konzerthalle, deren Wände eine hohe Holzdecke tragen. ›Dann warten wir mit den Kindern hier drinnen, bis es vorbei ist‹, erzählt die Sängerin.
Dschenin mit seinen nur 50.000 Einwohnern könnte ein verschlafenes Nest irgendwo im nördlichen Westjordanland sein. Die Stadt hat keine große Altstadt wie Nablus, keine wichtigen Regierungsgebäude wie Ramallah und auch umstrittene heilige Orte wie in Jerusalem gibt es hier nicht. Trotzdem wurde hier im vergangenen Jahr, das im Westjordanland das blutigste seit rund 20 Jahren war, mit am heftigsten gekämpft. Warum?
Dschenin war schon vor der Staatsgründung Israels ein Ort, den die britischen Mandatsbehörden nur schwer kontrollieren konnten, doch für Haj Hassan liegt die Antwort vor allem im Jahr 2002. Die Musiklehrerin war damals in der ersten Klasse, als die israelische Armee mit Panzern und Bodentruppen das Flüchtlingslager neben der Stadt besetzte, direkt vor den Fenstern ihres Kinderzimmers. Zuvor hatten Palästinenser während der zweiten Intifada von Dschenin aus rund zwei Dutzend Selbstmordanschläge mit zahlreichen Toten in Israel verübt. ›Ich konnte sehen, wie die Soldaten und die jungen Bewohner des Camps sich bekämpften‹, erinnert sie sich. Einmal sei ihr Fenster durch eine Explosion zersplittert, als sie mit ihrem Bruder im Nebenraum spielte.
Wörter: 2269
Lesezeit: ~ 12 Minuten
Diesen Artikel können Sie um € 3,50 komplett lesen
Wenn Sie bereits Printabonnentin oder Printabonnent unseres Magazins sind, können wir Ihnen gerne ein PDF dieses Artikels senden. Einfach ein kurzes Mail an office@datum.at schicken.