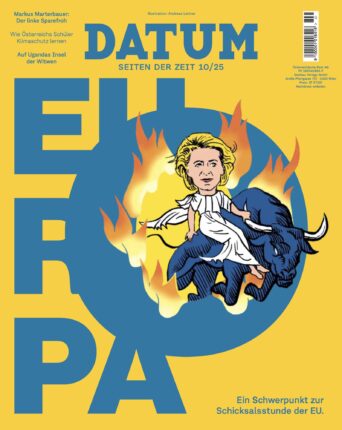Wie es ist … Krieg zu fotografieren
Es gibt genug Fotografen, die den Krieg so abbilden, wie man ihn sich vorstellt: weinende Mütter, zerstörte Gebäude, verletzte Kinder. Krieg wirkt von Natur aus fotogen, weil er zerstörerisch ist. Doch in dieser Zerstörung verbergen sich viele Details und diese einzufangen, ist viel schwieriger.
Ich sage immer, ich fotografiere keinen Krieg, sondern die Schönheit und die Widerstandskraft der Menschen vor Ort. Als ich in Gaza war, habe ich eine Hochzeit fotografiert. Obwohl zeitgleich ein Bombenangriff stattfand, gaben sich zwei Menschen mitten im Krieg das Ja-Wort. Hoffnungsvoll zu sein und sich trotz schlimmster Umstände und Grausamkeiten für Liebe zu entscheiden, zeigt, wie ein Leben inmitten von Kämpfen und Gewalt auch aussehen kann.
Die größte Herausforderung an meinem Job ist es, am Leben zu bleiben. Wenn meine Schwester liest, dass es wieder einen Bombenangriff gab, lüge ich sie manchmal an: Die Bombe sei weit entfernt eingeschlagen, dabei ist sie in Wirklichkeit nur wenige hundert Meter von mir entfernt explodiert. Ich habe gelernt, nur so viel zu erzählen, dass sich niemand allzu große Sorgen macht. Immerhin bin ich schon den Großteil meines Lebens humanitärer Helfer und Fotograf, die meisten, die mir nahestehen, haben sich also schon daran gewöhnt.
Einmal in Gaza war ich in einem Krankenhaus, als in der Nähe Luftangriffe stattfanden. Die Wände bebten so heftig, dass ich dachte, ich sterbe. Die Angst kommt, wenn die Bomben nahe sind oder wenn ich nach einem Luftangriff in ein Gebäude gehe, das jeden Moment einstürzen könnte. Was mir hilft, ist, mich zu erden und mich daran zu erinnern, warum ich hier bin. Ich schaue auf die Menschen um mich herum – Ärztinnen, Kinder, Freiwillige – und sage mir: Wenn sie nicht aufgeben, darf ich es auch nicht. Manchmal helfe ich mir auch mit Humor. Sich gegenseitig aufzumuntern und einander Witze zu erzählen, beruhigt mich mehr als alles andere.
Als Fotografen nehmen wir meistens etwas von den Menschen – ein Bild, einen Moment. Aber wir müssen auch lernen, etwas zurückzugeben. Oft drucke ich meine Bilder aus und gebe sie den Menschen vor Ort. Viele haben all ihr Hab und Gut verloren oder mussten fliehen und ihre Habseligkeiten zurücklassen. Die ausgedruckten Fotos werden so zu neuen Erinnerungsstücken.
Einmal habe ich einen Großvater fotografiert, der seine ganze Familie bei einem Bombenangriff verloren hat. Die einzigen, die überlebten, waren er und seine zwei Enkel. Es war unfassbar traurig und dramatisch. Kurz habe ich gezögert und mich gefragt: Ist das wirklich der richtige Moment, um ein Foto zu machen? Der Großvater hat nicht nur zugestimmt, sondern begann zu erzählen. Er wollte, dass Menschen wissen, was passiert war. Als ich mir danach das Bild ansah, bemerkte ich erst die Wucht des Fotos. Im Moment habe ich oft das Gefühl, die Kamera sei ein Schutzschild. Als würde ich die Realität nur beobachten, anstatt ihr wirklich zu begegnen. Doch wenn das Adrenalin abfällt, spüre ich wieder alles. Manche Bilder brennen sich in mein Gedächtnis ein.
Wenn Menschen meine Fotos sehen, erhoffe ich mir, dass sie beginnen nachzudenken. Wir lesen meistens nur Zahlen von getöteten Zivilisten. Doch jede einzelne Person hat eine Geschichte, hat Träume und auch Wünsche. Manchmal ist es einfacher, ein Foto herzuzeigen, als ihre Geschichten und das Erlebte in Worte zu fassen. •
Mattia Bidoli (40) ist humanitärer Helfer und Fotograf. Er war bereits bei Einsätzen in Belarus,
dem Libanon, der Ukraine und Gaza.