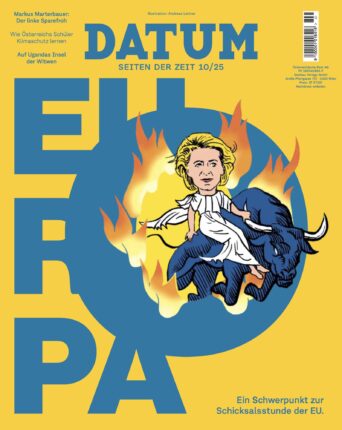Davor und Danach
Bei Livevideos von Laien fällt das redaktionelle Gatekeeping weg. Traumatisierende Bilder verbreiten sich rasant. Wie man Gewaltereignisse und Tod verantwortungsvoll bebildert.
Die Situation auf dem Universitätscampus in Utah war chaotisch. Durch die Kameralinse blickte Tess Crowley in panische, entsetzte Gesichter. Die Hände der jungen Fotografin der Tageszeitung Deseret News aus Salt Lake City zitterten, als sie auf den Auslöser drückte, erinnert sie sich in einem Gespräch mit MLive, einem Medium aus ihrem Heimatstaat Michigan.
Wenige Augenblicke zuvor, um 12 Uhr 23, war der rechte Aktivist Charlie Kirk während seiner Veranstaltung vor den Augen von rund 3.000 Zuschauern erschossen worden. Rasant verbreiteten sich Videos vom Schuss aus verschiedenen Perspektiven, in Zeitlupe und Echtzeit. Millionen von Menschen klickten sie an. In den Newsfeeds, Storys und Messenger-Gruppen tauchten drastische Bilder ohne Vorwarnung auf. Manche brennen sich ein, traumatisieren, entzünden eine politische Debatte und prägen das kollektive Gedächtnis.
Alan Schroeder, emeritierter Journalismus-Professor an der Northeastern University in Boston, erinnert an das Foto ›Saigon Execution‹ von 1968: ›Es zeigt nicht die Folgen einer Schießerei, sondern einen Mann, der erschossen werden soll.‹ Auch das Foto ›Falling Man‹, das Richard Drew direkt nach dem Anschlag vom 11. September 2001 auf das World Trade Center aufnahm, habe viel Kritik ausgelöst.
Dennoch galt damals zumindest noch das Tabu, nicht das Ableben selbst zu zeigen. ›In beiden Beispielen sehen wir das Opfer im Augenblick unmittelbar vor dem Tod, nicht den tatsächlichen Tod‹, sagt Schroeder.
Seit das Publikum mit Smartphones bei Veranstaltungen mitfilmt und Inhalte in Echtzeit veröffentlicht, fällt bei derartigen Gewaltereignissen immer häufiger das journalistische Gatekeeping weg. ›Schockierende Bilder drängen zwar zu einer raschen Reaktion, aber seriöse Medien dürfen sich nicht vom Tempo treiben lassen. Sie verifizieren, wählen aus, achten auf ethische Kriterien bei der redaktionellen Entscheidung‹, erklärt Sarah Kreps, Politikwissenschaftlerin an der Cornell University. Sie glaubt, dass sich die Bildsprache verändert: ›Online erscheint immer mehr Rohmaterial, Videos aus der Ich-Perspektive dokumentieren zunehmend Ereignisse‹, sagt Kreps. Redakteure könnten einen Mehrwert schaffen, indem sie diese Unmittelbarkeit mit Kontext, Untertiteln und Analysen kombinieren, ergänzt die Forscherin. Während sich die Erwartung des Publikums, das ›alles sehen will‹, geändert hat, bleiben ethische Fragen rund um Einwilligung, Persönlichkeitsrechte, Würde und Schadensminimierung bestehen. Die Arbeit der Bildredakteure verschiebt sich mehr und mehr von der Zugangskontrolle hin zur Verifizierung und Einordnung der Inhalte. Redakteure müssten ihre Entscheidungen offen begründen. Denn Transparenz schafft Vertrauen. Und das ist wichtig, da das Misstrauen gegenüber professionellen Journalisten wächst.
›Der Kontext ist es, der Journalismus von der reißerischen Zuschaustellung unterscheidet‹, betont Kreps. Schließlich sollten wir mehr und anderes als nur einen erschütternden Clip in Erinnerung behalten.
Anstatt expliziter Inhalte nutzen Medien weltweit, etwa die New York Times, Washington Post, politico.com oder El País deshalb Fotos wie jene von Tess Crowley, um ihre Berichte über das Attentat auf Charlie Kirk zu bebildern. Sie zeigen, wie Kirk bei seinem Auftritt Fan-Kappen in die Menge wirft und dann danach, wie die Zuseher erschrocken wegstürmen. Es gibt mehrere Gründe, weshalb Redaktionen entscheiden, einen Gewaltakt selbst nicht abzubilden: aus Pietät und Rücksichtnahme, um nicht zur Nachahmung anzuregen oder Traumata auszulösen.•