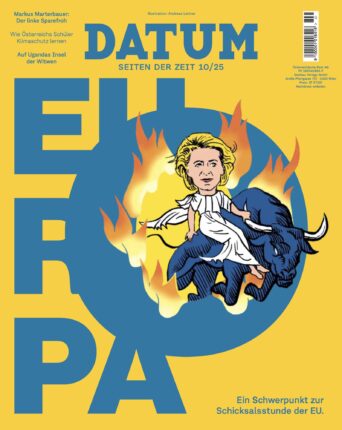Spielen statt verzweifeln
Die Klima- und Umweltbildung hierzulande ist ungenügend, stellt der neue österreichische Klimasachstandsbericht fest. Die Initiatoren des Weltklimaspiels wollen das ändern – und Jugendlichen das Gefühl zurückgeben, dass nicht alles verloren ist.
Von oben betrachtet, ist der Planet fast leer. Nur in den Regenwäldern tummeln sich ein paar Tiger und Eidechsen, in Mooren Frösche und Libellen, die Sonne scheint. Doch plötzlich legt sich ein Schatten über das Land. Dort, wo der Ozean im Nichts endet, stehen zwei Dutzend 16-Jährige und starren etwas verschlafen auf den Nordpol hinab. Wie klein die Welt doch manchmal ist.
Um genau zu sein, misst sie Anfang September drei Schultische und steht mitten in der Mehrzweckhalle eines Gymnasiums im dritten Bezirk Wiens. Über die nächsten Tage werden die Schülerinnen und Schüler ein ganzes Jahrhundert Spielzeit auf dem Planeten Orasis verbringen. Das Weltklimaspiel simuliert mithilfe einer App das globale Wirtschaft- und Klimasystem von 2000 bis 2100 in Zehn-Jahres-Abständen. Entwickelt von der gemeinnützigen Weitblick GmbH, wird es seit rund zwei Jahren in Österreichs Schulen, Lehrlingsstellen und Universitäten gespielt. Für diese sechste Klasse hat eine Schülerin das dreitägige Event bei einem Poetry-Slam-Wettbewerb gewonnen.
Die Welt ist wie im Brettspielklassiker Catan mit sechseckigen Plättchen in verschiedene Bereiche geteilt. Auf unsere Erde umgelegt, repräsentiert jedes einzelne ungefähr die Fläche von Österreich, Deutschland und der Schweiz zusammen. An den Rändern des Spielbretts ist eine Skala für die Lebensqualität und das Bevölkerungswachstum aufgezeichnet. Daneben die Klimapfade von 1,5 bis vier Grad mitsamt zugehörigen Kipppunkten. Kleine Totenköpfe markieren Entwicklungen, die nicht rückgängig zu machen sind. Ein Marker in Form einer Sanduhr zeigt an, welches Jahrzehnt und welcher Klimapfad gerade aktuell sind.
Die Spielleiterin Lisa Lorenz versammelt alle Schüler um die Weltkarte. Sie und ihre Kollegin Katharina Haas erklären zuerst das Einmaleins der Klimawissenschaft: Treibhauseffekt und CO₂. Auch in der Geschichte von Orasis werden die Menschen sesshaft und die Industrialisierung findet statt. Währenddessen tauchen schon die ersten Fragezeichen in den Gesichtern der Schülerinnen und Schüler auf. Vor allem bei Philipp, einem leidenschaftlichen Spieler, wie er in einer Pause später erklärt. ›Was ist denn eigentlich das Ziel des Spiels?‹ ›Schauen wir mal‹, weicht die Spielleiterin aus. ›Also wir setzen uns unser eigenes Ziel?‹ Philipp lässt nicht locker. ›Philipp!‹, ›Jetzt wart’ doch mal ab!‹ Die restliche Klasse ist genervt, doch Philipp beeindruckt das wenig: ›Ist es denn eher so ein Rollenspiel?‹
Tatsächlich werden im nächsten Schritt kleine Anstecker ausgeteilt. Die Rollen reichen von Regierungschefin der verschiedenen Länder über CEOs von internationalen Konzernen bis zu Vertretern der Zivilgesellschaft und der UIO – der Unabhängigen Internationalen Organisation. Nachdem sich im Sesselkreis alle in ihren Fraktionen zusammengefunden haben, folgt eine kurze Vorstellungsrunde. Samuel steht als erster auf und ist sich seiner Sache sehr sicher: ›Hallo, wir sind die Zivilgesellschaft und für das Wohl aller zuständig. Und dafür, dass der Planet gut bleibt. Also macht keine Faxen, denn sonst können wir euch flachlegen.‹ Kurz Stille. ›Auf eine gute Zusammenarbeit.‹
Zusammenarbeit wird groß geschrieben in der schulischen Klimabildung. Schließlich braucht das interdisziplinäre Thema eine fächerübergreifende Mitarbeit. Obwohl seit dem Schuljahr 2023/24 das Unterrichtsprinzip ›Bildung für nachhaltige Entwicklung‹, abgekürzt BNE, in den neuen Lehrplänen verankert ist, bleibt das Aufgreifen von Klima- und Umweltthemen in der Praxis oft an einzelnen engagierten Lehrkräften hängen. ›Und ohne eine aufgeschlossene Direktion geht schon mal gar nichts‹, raunt ein HTL-Lehrer, der sich zum Spielleiter ausbilden lässt und die Runden heute begleitet. Österreichs Schulsystem ist streng hierarchisch organisiert, Lehrpersonen sind ihren Direktoren weisungsgebunden. In vielen Schulen beschränkt sich der Unterricht über die Klimakrise auf naturwissenschaftliche Fächer.
Weltweit betonen Wissenschaftler allerdings die Bedeutung von Klimabildung in allen Schulbereichen. In einer einflussreichen Studie der österreichischen Forscherin Ilona Otto vom Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Universität Graz nimmt Bildung eine zentrale Rolle ein. Als eine von sechs ›Interventionen‹ soll die Klimabildung zu einer raschen Dekarbonisierung beitragen, indem sie Werte, Normen und schlussendlich auch Verhalten verändert. Als sozialer Kipppunkt werde diese Entwicklung nach Überschreiten einer bestimmten Schwelle zum Selbstläufer.
Entgegen der allgemeinen Auffassung lasse sich über das Bildungssystem so ein schneller Wandel herbeiführen, argumentieren Otto und ihre Kollegen. Der neue österreichische Klimasachstandsbericht, der den aktuellen Stand der Wissenschaft zur Klimakrise zusammenfasst, teilt diese Auffassung. Und er kritisiert, das österreichische Bildungssystem trage in seiner jetzigen Form nicht genug zu einer nachhaltigen Zukunft bei. Im Gegenteil, es behindere sogar ›die Förderung von handlungsorientierter und partizipativer Klimabildung‹.
Ein Bursche namens Haris lacht laut auf. Spielleiterin Lorenz hat in einem Satz das Verb ›behindert‹ benutzt. Als reihum die Treibhausgasemissionen der Länder und Konzerne bekanntgegeben werden, folgt jeweils ein hörbares ›Sheesh‹ auf eine besonders hohe Anzahl Gigatonnen. Die Welt kommt nun im 21. Jahrhundert an, die Auswirkungen von Industrialisierung, Massentierhaltung und Monokulturanbau werden am Spielbrett sichtbar. Wälder, Äcker und Weiden degradieren und speichern weniger CO₂. Noch vor Spielbeginn spüren die Schüler die negativen Auswirkungen, können aber nichts daran ändern.
›Es ist ganz wichtig, dass die Kids selbst die Plättchen umdrehen‹, erklärt Co-Leiterin Katharina Haas flüsternd, während Lorenz die Regierungschefs nacheinander ans Spielbrett holt. Ein umgedrehtes Plättchen zeigt eine beschädigte Landschaft an und kann später schlechter für Acker- oder Städtebau genutzt werden. Wird dieselbe Region noch einmal geschädigt, verödet sie komplett und verschwindet aus dem Spiel. Die Schüler sollen ein Gefühl für den Wert der natürlichen Ressourcen in ihren Ländern entwickeln. Als letzten Vorbereitungsschritt werden App und Wirtschaftssystem über eine Präsentation am Beamer erklärt. In dem abgedunkelten Raum nickt eine Handvoll Jugendlicher ein. Danach läutet die Schulglocke schrill zur Mittagspause.
Nach gut vier Stunden Einführung startet das Weltklimaspiel nun so richtig. Zu Beginn jedes Jahrzehnts werden Umweltkrisen verteilt. Die Schüler holen sich die Dürren, Überflutungen oder Insektenplagen wie in einem Drive-Thru bei Haas ab. Um etwa einen Borkenkäferbefall zu verhindern, müssen die Baumarten im Wald angepasst werden, sodass dieser resilienter wird. Ob das erfolgreich ist, wird per Würfel entschieden. Geht der Wald kaputt, sinkt auch die Lebensqualität im Land, was wiederum Krisen begünstigt.
Danach kommt die Verhandlungsphase. ›Ey, brauchst du Öl und Gas?‹, fragt Philipp, Chef eines Bergbauunternehmens, seinen Sitznachbarn. ›Wir reden, wir reden!‹ Die zwei klatschen ein. Staaten müssen ihren Bürgerinnen und Bürgern genügend Essen, Kleidung und Wohnraum zur Verfügung stellen, dafür sind sie auf die Konzerne angewiesen, die jeweils große Industriezweige repräsentieren. Angebote werden gemacht, es wird gefeilscht, Deals werden abgeschlossen.
Auch Gesetze und Verträge können aufgesetzt werden. Dafür gibt es ein Schwarzes Brett im Büro der UIO, an dem diese öffentlich ausgehängt werden. Die zwei UIO-Vertreterinnen Clara und Viktoria haben es etwa geschafft, dass alle Staaten noch vor 2010 eine Vereinbarung unterzeichnen, die Krieg als völkerrechtswidrig verbietet. Wenig später deutet Katharina Haas auf ihren Monitor. ›Schau mal, jetzt wird’s spannend‹, sagt Haas. ›Sie haben Atomwaffen gekauft.‹
›Kinder und Jugendliche spielen noch mehr‹, sagt Matthias Mittelberger, Mitentwickler und Spieleautor des Weltklimaspiels. ›Wenn militärische Eroberung ein Teil der Möglichkeiten ist, dann machen sie das. Was wiederum eine wunderbare pädagogische Steilvorlage ist, um über Krieg und Gewaltspiralen zu reden.‹ Mittelberger hat mittlerweile aufgehört zu zählen, wie viele Klimaspiele er bereits geleitet hat. Die Rolle des Moderators ist ihm an seiner Erzählerstimme anzumerken. ›Das Weltklimaspiel ist wie eine Anfrage, in welcher Welt du leben willst‹, sagt der studierte Philosoph und Politikwissenschaftler. Die Antworten eines Lehrlings und eines Gymnasiasten darauf unterscheiden sich fast nicht, sagt er aus Erfahrung. Es gebe die gleichen Konflikte, Strategien und Gruppendynamiken. ›Massiv unterschiedlich ist nur das Vorwissen‹, sagt Mittelberger. ›An Mittelschulen sind die Schüler mit dem Thema beispielsweise noch so gut wie gar nicht in Berührung gekommen.‹ Deshalb erklären die Spielleiter zwischendurch immer ein paar Zusammenhänge zwischen Klimakrise und unserer heutigen Gesellschaft.
Für die Spielentwicklung hat sich die Weitblick GmbH Forscher des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse ins Boot geholt. Sie werben damit, dass das Spiel wissenschaftlich fundiert und relativ realistisch ist. Startpunkt ist dennoch im Jahr 2000. Geben wir uns damit nicht 20 Jahre Vorsprung, die wir eigentlich nicht haben? ›In der Theorie, ja‹, sagt Mittelberger. ›In der Praxis sind die Spieler in den ersten Runden dermaßen überwältigt von der Komplexität der Krise, dass sie in der Regel keine besonders klugen Schritte setzen.‹
Zu Beginn des zweiten Tages hat die UIO auf Orasis bereits eine CO₂-Steuer für alle Konzerne durchgesetzt, zehn Jahre früher, als wir es hierzulande in der Realität hatten. Das Problem damit bemerken Clara und Viktoria erst, als im Sesselkreis alle ihre Aktionen der letzten Runde verkünden. Außer Benjamin und Amelie vom größten Energiekonzern hat niemand bezahlt. Die Emissionskurve zeigt nach oben, die Welt rutscht in den Zwei-Grad-Klimapfad und die Umweltkatastrophen werden häufiger. Teilweise sind die Schülerinnen und Schüler noch immer dabei, die Mechaniken auszuprobieren, ein Konzern kauft etwa eine Söldnertruppe, ›weil es Männer sind, die cool sind und tough aussehen‹. Andererseits helfen sie einander wie selbstverständlich bei der Bewältigung von Krisen und Extremwetterereignissen.
Ganz zur Freude ihrer Klassenvorständin. Die Deutschlehrerin integriert auch Klima- und Umweltthemen in ihren eigenen Unterricht, etwa als Lesematerial bei Übungen für die Zentralmatura. Manchmal werde es ihren Schülern bereits zu viel, meint sie. Immer wieder haben auch andere Lehrer Aufsichtspflicht während der Spielrunden. Die Religionslehrerin der Klasse meint, im neuen Lehrplan finde Klima nun viel häufiger statt. ›Schöpfungsverantwortung‹ nenne sich das. Auch die Spanischlehrerin wählt für Reading-Aufgaben Texte zur Klimakrise.
›Jedes Schulfach hat das Potential, Klimathemen zu behandeln‹, ist sich Matthieu Floret von den Teachers For Future sicher. Um Klimabildung von der individuellen auf die institutionelle Ebene zu heben, fordert er einen Klimabeauftragten an jeder österreichischen Schule. Das sind Lehrpersonen, die dem Thema im Schulalltag eine Stimme geben sollen, Projekte initiieren und organisieren. In Wien ist in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion bereits eine Koordinationsstelle für diese Rolle eingerichtet worden. In den Bundesländern sucht man noch vergeblich danach. Auch das neubesetzte Bildungsministerium nähme sich der Lücke nicht an. ›Die derzeitige Umsetzung ist ein glatter Fünfer‹, kritisiert Floret. ›Angesichts der Größe der Krise ist das nicht annähernd genug.‹ Die Arbeit der Klimabeauftragten ist außerdem unbezahlt, das müsse sich als erstes ändern. In einem offenen Brief wandten sich die Teachers For Future bereits Ende 2023 an den damaligen Bildungsminister Polaschek (ÖVP).
Heute, bald zwei Jahre später, sind ihre Forderungen von damals noch immer unerfüllt und aufrecht. Man kann Matthieu Florets Achselzucken fast durch das Telefon hören: Österreichs Bildungssystem sei eben leider sehr träge, sagt er. Und Klimabildung chronisch unterfinanziert, ergänzt Matthias Mittelberger: ›Die wenigen Bildungsanbieter in diesem Bereich kriechen alle um dieselben kleinen Fördertöpfchen herum.‹
Wenn Katharina Haas keine Weltklimaspiele mitleitet, ist sie Koordinatorin des Klima-Puzzles, ebenfalls ein, wenn auch kürzeres, pädagogisches Spiel zur Erderhitzung. ›Die Schüler:innen brauchen nicht noch mehr Infos zu Krisen, sondern Ideen, wie sich diese gemeinschaftlich lösen lassen und ein Gefühl von Selbstwirksamkeit‹, sagt Lisa Lorenz. Dafür eignen sich Planspiele wie das Weltklimaspiel, aber auch Projektunterricht oder Naturerfahrungen, liest sich auf der Website des Bildungsministeriums. Die zwei Kolleginnen halten eine letzte Besprechung vor der finalen Reflexionsrunde am Ende des dritten Tages. Die Schülerinnen der sechsten Klasse haben sich gut geschlagen. An diesem Morgen sind sie pünktlich 2050 klimaneutral geworden, auch wenn sie zeitweise den Weltmarkt etwas zusammengefahren haben. ›Man sollte das Spiel echt einmal mit Entscheidungsträger:innen spielen‹, seufzt Haas.
In den 2060er-Jahren kommt plötzlich das Ende, sehr zur Enttäuschung der Schüler. Einige hätten wohl noch gerne die Atomwaffen ausprobiert. Da das Weltklimaspiel kein vorgegebenes Ziel hat, ist es aus, wenn die drei Tage um sind. Die Schülerinnen und Schüler hinterlassen Orasis mitten in der Transformation zu einer klimafitten Zukunft, jedenfalls aber grüner als zu Beginn.
Die finale Fragerunde im Sesselkreis dreht sich darum, wie sich die Jugendlichen mit der Klimakrise in der realen Welt fühlen. ›Traurig, denn ich bin ein großer Fan von Skifahren‹, erklärt Bruno. ›Ich finde es blöd, dass es immer weniger Schnee gibt, deshalb versuche ich mich möglichst umweltfreundlich zu verhalten. Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen.‹ Clara, Leoni und Sabrina hingegen zeigen sich eher skeptisch: In der echten Welt hätten viel weniger Leute Interesse an Klimaschutz, viel mehr würden sich dagegen stemmen. Insofern sei das Spiel zu leicht und unrealistisch gewesen, sagt Leoni. Selbst in ihrer eigenen Klasse gebe es genug, denen das Klima egal ist, sagt Clara.
Die Spielleiterin sieht das anders. ›Macht alle die Augen zu. Alle, denen die Klimakrise ein Anliegen ist und die möchten, dass sich etwas verändert auf dem Planeten, heben bitte einmal die Hand‹, sagt Lisa Lorenz. ›Ihr könnt die Augen nun wieder aufmachen.‹ Bis auf eine ist jede Hand oben. •